Pflanzen reichen aus
Ein veganer Landbau, der komplett unabhängig von Nutztieren funktioniert, sei ohne weiteres möglich – und nötig, argumentiert der schreibende Gärtner Jan-Hendrik Cropp.
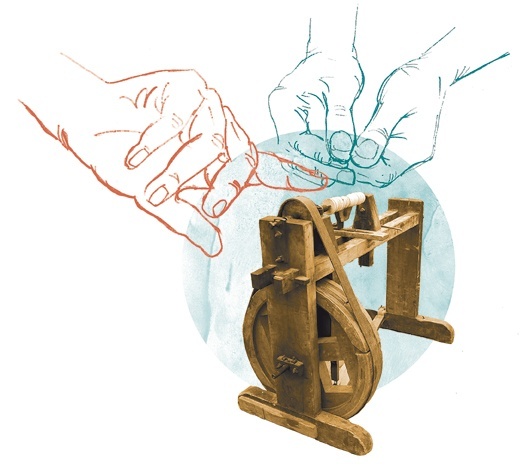
Um das Jahr 1780 geriet Europa an den Rand einer ernsten Energiekrise: Das Holz, das bis dahin vor allem als Brenn-, Bau- und Werkmaterial stets zu den grundlegenden Stoffen der Menschen gehört hatte, wurde knapp. Was in dieser brisanten Lage nicht nur den Druck auf den Wald minderte, sondern sogar den unglaublichen industriellen Aufschwung »befeuerte«, war – neben der Einführung gezielter Aufforstungsmaßnahmen – die Entdeckung der Kohle. Etwas später gesellten sich dann bekanntlich noch weitere fossile Energieträger und Industriewerkstoffe wie Erdöl und Uran zur Kohle – bis zum gegenwärtigen Punkt, an dem die gesamte globalisierte Industriezivilisation in beinahe allen Lebensaspekten völlig abhängig von fossilen Energieträgern geworden ist, vor allem vom Öl. Der Musiker und Hobby-Elektroauto-Entwickler Neil Young hat diese Tatsache einmal im Interview mit einer etwas derben Metapher umschrieben: »Wir hängen alle an der Dinosaurier-Titte«.
Muss hier noch ein Wort über die Gefahren im Zusammenhang mit Erdölprodukten verloren werden? Über die Auswirkung der Verbrennung fossiler Energieträger und unserer vollständigen Abhängigkeit von wenigen Stoffen, die in absehbarer Zeit unerschwinglich teuer sein und irgendwann zur Neige gehen werden, in 20, 60 oder in 200 Jahren? Im Grund genommen wissen alle über die Endlichkeit des derzeitigen Lebenssaftes Erdöl Bescheid – und dennoch können wir nicht umhin, uns die schöne neue »grüne« Welt der Zukunft vorzustellen mit – genau: Photovoltaikanlagen, Windrädern, Fabbern, Smartphone-Technik und so weiter. Dass diese Apparate aber nur so lange funktionieren, wie die gesamte biosphärenfressende Industriemaschinerie läuft und der dieselbefeuerte Nachschub mit Rohstoffen und Ersatzteilen gesichert ist, das verdrängen wir gerne.
Was also, wenn die hochkomplexe – und deswegen hochgradig anfällige – Industriezivilisation, anders als die Menschen der Holzkrise im 16. und 18. Jahrhundert, für die Zeit nach Erdöl, Uran, Phosphor oder seltenen Erden keine Substitute findet? Autoren wie Richard Heinberg sprechen ja bereits vom nahen Ende der nur wenige Jahrzehnte währenden »Öl-Party«, und der radikale Ökophilosoph Derrick Jensen zeigt sich sogar erleichtert, dass wir Heutigen »zu den letzten Generationen gehören, die den Krach von Verbrennungsmotoren ertragen müssen«.
Welches Wissen ist wichtig?
Oft ist zu hören, dass wir heute noch nicht genau sagen könnten, wie die nachhaltige Gesellschaft aussehen wird. Ich wage zu behaupten, dass die erdölfreie Zukunft in vielerlei Hinsicht dem technischen Stand der Welt unserer Urgroßeltern gleichen wird. Auch der Transition-Town-Vordenker Rob Hopkins hat das begriffen und in seinem »Energiewende-Handbuch« dazu aufgerufen, die alten Menschen um Rat zu fragen, denn die hätten ja oft noch eine Zeit vor den Auswirkungen des billigen Öls erlebt und erinnerten sich möglicherweise, wie man etwa Lebensmittel ohne Kühlschrank aufbewahrt, Wäsche von Hand wäscht oder mit Zugtieren pflügt. Ich frage mich, ob es nicht wichtiger ist, dieses alte Wissen in der Anwendung lebendig zu (er-)halten, als die schönste Öko-Hochtechnik zu erfinden, die sich in einer postfossilen Welt dann leider nicht mehr betreiben und produzieren lassen wird. Es ist nur zu gut verständlich, dass wir auf dem vorläufigen Höhepunkt der schier unfassbaren technischen Machbarkeit nicht auf die Idee kommen, dass die rauschhafte Öl-Party in wenigen menschheitsgeschichtlichen Augenblicken vorbei sein wird. Das Kollektivbewusstsein wiegt sich in dem Glauben, es würde alles schon irgendwie weitergehen. Die Bewohner der Osterinseln konnten sich auch nicht vorstellen, dass die Bäume auf ihrem Eiland irgendwann aufgebraucht sein würden. Sie hatten, so erklärt es Jared Diamond in »Kollaps«, schlicht keine Erfahrung mit dem Phänomen endlicher Ressourcen. An die eingangs erwähnte europäische Erfahrung der Holzkrise kann sich heute keiner mehr erinnern, und im Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit ist nicht einmal das ebenso junge wie lehrreiche Beispiel Kubas präsent, das mit dem Ende seines Handelspartners Sowjetunion 1991 auf vier Fünftel seiner Ölimporte verzichten musste, obwohl es davor noch seine Landwirtschaft hochgradig industrialisiert hatte. Ohne Traktoren, Pestizide und Kunstdünger bekamen die Kubaner plötzlich nichts mehr auf den Teller – und »erfanden« innerhalb weniger entbehrungsreicher Jahre ein arbeitsintensives, aber ölunabhängiges Agrarsystem, das heute die Insel mit ökologischen Regionalprodukten versorgt. Diese neue Landwirtschaft ähnelt in den meisten Aspekten dem traditionellen Anbau; so wurden etwa inselweit Lehrgänge zur Arbeit mit Pflugochsen durchgeführt, bei denen das Wissen der Alten plötzlich wieder gefragt war.
Hat es so etwas schon einmal gegeben: den freiwilligen technischen Rückbau einer ganzen Gesellschaft, die Abkehr vom Fortschrittsparadigma aus Vernunftgründen? Ich glaube nicht. Und ich würde auch nicht auf die dafür notwendige Einsicht bauen – ganz abgesehen davon, dass unsere Wirtschaftsmaschine auf ewiges Wachstum und Profitmaximierung programmiert ist und voraussichtlich auch völlig unabhängig von all unseren Einsichten so lange weiterbaggern wird, bis ihr endlich der Saft ausgeht oder aber nichts mehr zum Baggern übrig ist. – Nein: Technischer Rück-Schritt ist in patriarchal strukturierten Gesellschaften ein absolutes Tabu. Jeder auf öffentliche Wirksamkeit und die eigene Reputation bedachte Umweltschützer ist sich bewusst, dass grüne, wachstumskritische Argumente – zum Beispiel gegen technische Großprojekte – unbedingt stets von der Versicherung flankiert werden müssen, man wolle ja selbst gar nicht »zurück in die Steinzeit«.
Das Beste aus allen Epochen
Als Mensch mit einem latenten Hang zur Nostalgie fühle ich mich von kulturgeschichtlichen Museen angezogen. Insbesondere liebe ich seit einem Schulausflug das Freilichtmuseum Glentleiten in Oberbayern, wo es altehrwürdige Bauernhäuser, fast vergessenes Handwerk und faszinierende Landwirtschaftstechnik aus verschiedenen Epochen zu bestaunen gibt. Rob Hopkins würde das Gelände am Kochelsee gefallen. Ende September war ich nach vielen Jahren wieder einmal dort. Ich wollte prüfen, ob meine nostalgische Ader nicht vielleicht doch den visionären Blick eintrübt. Denn es ist ja so: Die meisten Leute bekommen eine Heidenangst bei dem Gedanken, vom heutigen Technikstandard »wieder zurück« in weniger bequeme Zeiten wechseln zu müssen. Ein Leben ohne Handy und Internet? Gar ohne Strom? – Kaum vorstellbar! Es sieht so aus, dass wir nicht nur physisch abhängig sind vom Öl, wir sind auch psychisch süchtig nach den technischen Annehmlichkeiten der Industrie-Zivilisation.
Beim Gang über das Museumsgelände versuchte ich also, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Leben auf vorindustriellem Technikniveau tatsächlich lebenswert sein kann. »Wäre das wirklich so schlimm?«, frage ich mich bei der Besichtigung dunkler Bauernstuben mit Kachelofen und unbeheizten Schlafkammern oder angesichts karger Arbeitsplätze wie etwa der Manufaktur für die in der alten Landwirtschaft so wichtigen Sensen-Wetzsteine. Unübersehbar war das Leben unserer Vorfahren von sehr viel physischer Arbeit geprägt – schließlich konnte man noch nicht auf ferne Quasi-Sklaven in quasi-kolonialen Sweatshop-Ländern zurückgreifen. Ich stelle mir vor, dass mein Hemd nicht aus Bangladesch kommt, sondern dass erst Lein auf einem Teil der örtlichen Äcker angepflanzt wird, um Fasern zu gewinnen. Auf der Glentleiten lerne ich, dass weite Flächen Europas durch den Leinanbau früher blau blühten. Vor der Verarbeitung der Fasern stehen das Ernten, Trocknen, Dörren, Brechen und Kämmen der Leinpflanze in jeweils eigenen manuellen Prozessen. Dann erst kommen das Spinnen des Garns, das Weben des Tuchs, das Schneidern des Hemds. Und schließlich all der Aufwand, der mit dem Wäschewaschen verbunden war! Dabei ist Kleidung ja nur ein Lebensbereich von vielen …
Ich muss an eigene schweißgetränkte Erfahrungen bei der Heuernte von Hand denken; oder wie ich einmal das Dach unseres Dorf-Pizzaofens mit selbstproduzierten Holzschindeln eindecken wollte – und bei der Hälfte der Fläche kläglich aufgab. Die weitgehende Selbstversorgung der Bewohner einer Region, das wird mir beim Museumsrundgang wieder einmal klar, ist eine anstrengende Angelegenheit. Aber gibt es einen anderen Weg, wenn man nicht auf Kosten anderer Menschen bzw. Generationen leben und auch die Geschenke der Erde nicht über Gebühr beanspruchen möchte? Wenn schlichtweg die Ressourcen für ein Rundum-Fremdversorgungssystem fehlen? Immerhin haben die Menschen jahrtausendelang die Kunst verfeinert, mit dem zu leben, was sie regional vorfanden. Denn auch das erkenne ich im Museum: Der Mensch ist ein genialer Erfinder und Improvisierer! Eine Binsenweisheit freilich angesichts der modernen Ingenieurskunst – und doch beruhigt sie mich in Hinblick auf kommende Herausforderungen. Schade, dass so viel Subsistenzwissen im Verlauf der Öl-Party verlorenging und verlorengeht! Muss das »Rad« in Gestalt der unzähligen Facetten der Technikkultur unserer Vorfahren von den Enkeln ein zweites Mal erfunden werden?
Gute und schlechte Technik?
Fast hätte ich eben geschrieben: »nachhaltige Technikkultur unserer Vorfahren«, aber diese Formulierung wäre wohl eine unzulässige Romantisierung. Sicherlich hat eine Steinaxt nicht die Zerstörungskraft einer Kettensäge oder eines Bulldozers. Doch experimentelle Archäologen fanden heraus, dass sich mit solch einem relativ primitiven Werkzeug eine mittelgroße Eiche in einer halben Stunde problemlos fällen lässt. Schon früh in der Geschichte haben unsere Ahnen durch Unbedachtheit immense Flächen verwüstet, indem sie Wälder abholzten oder ver-schwendeten (»schwenden« nannte man das Roden mit Hilfe des Feuers) oder auch mit simplen Holzpflügen in Hanglagen herumfuhrwerkten, was oftmals starke Humuserosion auslöste. Offenbar lässt sich auch mit einfacher Technik Missbrauch betreiben. Man kann – diese Weisheit habe ich einmal von einem Krishna-Anhänger in der Fußgängerzone geschenkt bekommen – mit einem Messer jemanden erstechen oder aber damit einem Kind ein Butterbrot zubereiten.
Die Erkenntnis »Es kommt darauf an, was man daraus macht« bringt mich zurück zur Frage »Wäre eine Rückkehr zur vorindustriellen Technik wirklich so schlimm?«. Im Museumsbereich zum Thema »Heu und Milch« glaube ich zum Beispiel zu sehen, dass die Ahnen zwar hart arbeiteten, dass die notwendigen Tätigkeiten aber ihre eigene Schönheit hatten: Sie vermittelten unmittelbar erfahrbaren Sinn, körperliche Bewegung, Verbindung zu Menschen, Tieren, Pflanzen, Landschaft, Elementen, Jahreszeiten – alles Dinge, deren Verlust heute oft beklagt wird. Ich glaube deshalb nicht, dass anstrengende Tätigkeiten an sich das Problem waren bzw. wären. Wir Menschen sind für so etwas gemacht.
Haben oder Sein?
Während meiner musealen Visionsreise fühle ich vor allem Beklemmung bei der Vorstellung an die deutlich patriarchalen Rahmenbedingungen, unter denen etwa die einfachen Menschen des Jahres 1800 leben und arbeiten mussten. Ich denke an – im Vergleich zu heute – relativ lebendige Dorfgemeinschaften, in denen aber überall Hierarchien aufscheinen; ich denke an Unterdrückung von Frauen, schlecht behandelte Arbeiter, materielle Ungerechtigkeit, an »Kleinmachung« der Menschen in Kirche und Schule, Körperfeindlichkeit, nach Willkür waltende Obrigkeiten, steuerfinanzierte Palastbaustellen, Militärpflicht und vieles mehr. Ja, ich weiß: All das macht uns heute noch das Leben schwer. Entscheiden nicht vor allem die sozialen, psychischen und spirituellen Aspekte über die menschliche Lebensqualität? Aufgrund unserer langen Entwicklungsgeschichte in Jäger-und-Sammler-Gruppen sind menschliches Glück und Zufriedenheit viel abhängiger von diesen immateriellen Dingen als von Hochtechnik. In einer lebendigen, egalitär-demokratischen, liebevoll-solidarischen Dorf- oder Stadtviertel-Gemeinschaft fühlen sich Menschen seit Jahrtausenden so wohl, dass der Gedanke an so etwas wie Unterhaltungselektronik zur Kompensierung von zu kurz kommenden Bedürfnissen seltsam erscheint. Konsumismus hat noch niemanden nachhaltig glücklich gemacht. Der Luxus von traditionellen Kulturen besteht seit jeher aus Zeit für Spiele, Geschichten, Lieder, Lieben, Rituale, Naturverbindung, Feste, Freundschaft – sowie für Basisdemokratie und nicht-entfremdende Arbeit. Solche lebensbejahenden Gemeinschaften gab – und gibt – es in der Geschichte des Menschen zigtausendfach. Wenn wir sie neu erfinden möchten, so hat das wenig bis gar nichts mit technischer Machbarkeit zu tun! Wir müssten es nur wollen und dann eine Weile nach dem richtigen sozialen »Dreh« forschen – wobei uns wiederum die alten Menschen aus entsprechenden Traditionen beistehen können. Es geht im Kern also um »Kultur-Technik«, die Welt bedarf heute vor allem sozialer Innovation. Rein materielle Technik kann dem Menschen äußerst hilfreich sein, das ist unbestritten. Sie ist dabei aber vermutlich weniger wichtig, als wir zur Zeit der allgemeinen Maschinenanbetung glauben.
Zwischendurch ein Geständnis: Es gibt einen Punkt am gegenwärtigen Stand der Technik, über den ich manchmal sehr froh bin, und zwar die Notfallmedizin zur Versorgung von Unfallopfern und kariösen Eckzähnen. Wie sich diese wertvollen Errungenschaften der Industrialisierung in die Zeit nach der Öl-Party hinüberretten ließen, ist mir allerdings schleierhaft – mal sehen, was die Enkelinnen sich einfallen lassen!
Der Vorteil, den wir Heutigen gegenüber früheren Gesellschaften haben, liegt in einem immensen Wissensschatz, der es uns ermöglicht, das Beste aus allen Zeiten sinnvoll zu kombinieren. Zum Beispiel haben wir Erfahrungen mit kollabierenden Biotopen gemacht und könnten diese in die neu zu entwickelnden Kulturen einfließen lassen, damit die Werkzeuge, die wir zukünftig wieder aus vorrangig regionalen Materialien bauen werden, nicht noch einmal unsere Landbasis zerstören.
Kooperative Zukunft
Mit all unserem Wissen, unseren Erfahrungen und auch mit den materiellen Hinterlassenschaften der kurzlebigen Industrie-Zivilisation – ich denke etwa an Unmengen produzierten Eisens, das sich für Hufeisen und entsprechende Landtechnik upcyceln ließe – werden wir auch nach dem Ende des Ölzeitalters nicht in die »Gefahr« einer neuen Steinzeit geraten. Das Leben könnte weitergehen, gut weitergehen – wenn wir es klug anstellen und uns auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren statt auf die verbissene Aufrechterhaltung einer Megatechnik, die uns letztlich nicht froh macht, sondern nur den Planeten ruiniert.
Während ich durch die Hammermühle im Freilichtmuseum gehe, stelle ich mir vor, dass wieder überall Schmieden stehen. Es sind Commons-Schmieden, wo nicht nur Bekanntes reproduziert, sondern auch an bislang unbekannten Lösungen geforscht wird. Daneben gibt es auch wieder Gewerke wie Seiler, Weber, Meier, Müller, Schneider, Schuster usw.; einige davon werden im Kollektiv betrieben. Das Traumbild könnte aus Urgroßmutters Zeiten stammen, und doch ist alles ganz anders, wenn ich genauer hinsehe. Ich stelle mir freie, schöne Menschen vor, die die früheren Agrarwüsten wieder in artenreiche Gärten verwandeln; sehe die Schönheit, die in der Kooperation auch mit Tieren liegt; erahne Städte, die sich gänzlich neu erfinden …
Mir ist bewusst, dass die momentane kulturelle Wirklichkeit völlig gegen eine solche – übrigens sehr Gandhi-nahe – Vision steht und dass es Leute gibt, die meinen Traum vom einfachen, solidarischen, guten Leben als Kinder der Erde einen romantischen Schwachsinn nennen würden. Doch eine menschliche und zugleich hochtechnische Zukunft kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. – Und sieht es nicht sogar so aus, als ob derzeit auch größere Teile der Mainstreamkultur den Glauben an das technische Fortschrittsparadigma verlieren? •
Nach diesem Text Bücher lesen, nicht das Internet
• Richard Heinberg: Öl-Ende. »The Party’s Over« – Die Zukunft der industrialisierten Welt ohne Öl, Riemann 2004
• Derrick Jensen: Endgame/Das Öko-Manifest, Pendo 2008
• Jared Diamond: Kollaps, Fischer 2011 • Johannes Heimrath: Die Postkollaps-Gesellschaft, Scorpio 2012
• David Montgomery: Dreck, Oekom 2010
• Bernd Stefan Grewe: Der versperrte Wald: Ressourcenmangel in der bayer. Pfalz (1814–1870), Böhlau 2004
• Außerdem: John Seymours, Gudrun Sulzenbachers oder Rudi Pallas Bücher über alte Handwerkskünste.

Ein veganer Landbau, der komplett unabhängig von Nutztieren funktioniert, sei ohne weiteres möglich – und nötig, argumentiert der schreibende Gärtner Jan-Hendrik Cropp.

»Milchkaffee, entkoffeiniert bitte!« Die Verkäuferin schaut irritiert, sortiert die Fertig-Tabs, die sie in ihren Automaten pressen muss. »Das gibt es hier leider nicht«, sagt sie, »entkoffeiniert haben wir nur als Kaffee ohne Milch«. Ich schlage ihr vor,

Die derzeit zu beobachtenden Entwicklungen in der Tierhaltung und beim Fleischkonsum führen die Welt in den Abgrund. Wilfried Bommert berichtet von Züchtern, die dem Wahnsinn der Massentierhaltung Positivbeispiele entgegensetzen.