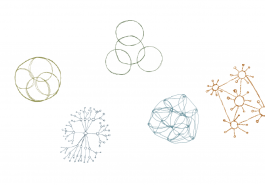TitelthemaWer macht’s?
Orte und Menschen erzählen davon, was Schreibtischarbeit und Schauspielerei miteinander zu tun haben, wer welche Akten liebt und warum erfundene Geschichten manchmal einen Stein ins Rollen bringen.In dieser Ausgabe erforschen wir Schnittstellen zwischen Orten des Gemeinschaffens und bürokratischen Institutionen. Wie gelingt es, gemeinschaffende Formen dauerhaft lebendig zu erhalten? Wie kann verhindert werden, dass Verwaltungsdenken in Projekte Einzug hält? Wie lassen sich juristische Spielräume ausschöpfen? In einem Mosaik lebensdienlicher Strukturen haben wir diesbezügliche Erfahrungen und bewährte Strategien von Menschen, die sich gemeinsam selbst organisieren, gesammelt.
Vier Redakteurinnen – Tabea Heiligenstädt, Luisa Kleine, Maria König und Andrea Vetter – haben die Berichte einer Reihe von Menschen protokolliert. In den Berichten aus ihren Gruppen taucht wiederholt eine Frage auf: »Wer macht’s? Wer genau hütet auf welche Weise welche Schnittstellen zu bürokratischen Institutionen?« Oft geht es zudem um die Wertschätzung der Schnittstellenarbeit – aber auch um Spannungen, die diese in Projekten auslösen kann. Wir haben Begebenheiten und Geschichten gesammelt, in denen ein kreativer Umgang mit Verwaltungsvorgaben gelungen ist.
Viele Herausforderungen haben mit den Rechtsformen – wie Verein, Genossenschaft oder GmbH –, in denen eine Gruppe organisiert ist, zu tun. Dem bestehenden Rechtssystem liegen nämlich einige Annahmen und Vorstellungen zugrunde, die sich mit den Werten vieler gemeinschaffend organisierter Gruppen beißen. Wenn Menschen etwas als gemeinsam verwaltetes, gehütetes und genutztes Gut miteinander teilen wollen und dies als Gegenmodell zum bestehenden Konzept des Privat-eigentums – mit dem Personen nach Willkür auch unsozial agieren können – begreifen, dann ist das im aktuellen Rechtssystem nicht vorgesehen. Um eine Beziehungshaftigkeit zu Dingen, Häusern, Gruppen und Projekten leben zu können, bedarf es häufig »legal Hacks« – juristischer Kniffe, die Rechtsformen auf ungewöhnliche, kreative Weise auslegen, so dass diese Formen für Commons nutzbar werden. Auch davon erzählen einige der folgenden Texte.

Jonathan Bumiller
Unsere Initiative heißt »Wo lang?«, das ist auch der Name unserer Rechtsformen: der GmbH und des wirtschaftlichen sowie des gemeinnützigen Vereins. Wir haben uns während unseres Studiums an der Alanus-Hochschule in Alfter kennengelernt, wo wir Kunst, Wirtschaft und Philosophie studiert haben und gemeinsam Konferenzen organisierten. Daraus ist der Impuls entstanden, weiter zusammenzuarbeiten. Im Herbst 2020 sind wir dann nach Altenburg gezogen, wo wir bequem zur Miete in verschiedenen Wohnungen eines Hauses in der Innenstadt leben. Wir sind mit der Perspektive gestartet, dass wir nicht scheitern können, dass uns nichts passieren kann. Es hat uns enorme Leichtigkeit gegeben, bis jetzt kein Eigentum und damit weniger Verpflichtungen zu haben. Für Konzerte oder auch Arbeitstreffen gibt es in Altenburg auch schöne gemeinschaftsgetragene Orte, daher war der Druck noch nicht so da.
Mittlerweile sind wir zu acht. Wir nutzen das alte Casino mit Ballsaal, das einem Architekten aus München gehört. Mit ihm haben wir keinen Vertrag, sondern können es einfach bespielen. Im Sommer vergeben wir dort erstmals Stipendien an künstlerisch arbeitende Menschen – in Kooperation mit dem Direktor der -Altenburger Museen und mit Unterstützung der »Kulturstiftung Thüringen« sowie des Programms »Neustart Kultur«. Außerdem haben wir am Roßplatz einen kleinen Mitgliederladen aufgebaut – eine Mischung aus Späti sowie Bio- und Tante-Emma-Laden. Als nächstes planen wir, eine alte Gärtnerei, die der Stadt gehört, wiederzubeleben und neben dem Gärtnern den Ort als Bildungs- und Kulturort weiterzudenken.
Der städtische Wirtschaftsförderer geht mit uns zu den Treffen der Stadtverwaltung, wo wir große Offenheit erfahren. Die Belebung der Stadt wird von allen Parteien willkommen geheißen. Ein Mitglied unserer Initiative wurde sogar in den Bauausschuss berufen. So pflegen immer wieder Einzelne von uns eine Beziehung zu einer Institution oder haben den Hut für gewisse Teilprojekte auf. Unser Ziel ist es jedoch, von Außen als Gruppe wahrgenommen zu werden.
Anton Eßwein lebt seit 2020 in der Kleinstadt Altenburg in Thüringen und mischt mit der Initiative »Wo lang?« das Städtchen auf.

huslyka.com
Der Rahmen, in dem wir uns als Hausgeburtshebammen bewegen, ist durch das Hebammengesetz, die Mutterschaftsrichtlinien, die Vorgaben der »Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe« sowie die Gesetzliche Krankenversicherung gesetzt. In den Mutterschaftsrichtlinien ist beispielsweise festgeschrieben, wie viele Ultraschalluntersuchungen empfohlen sind, ab wann eine Messung der Herztöne beim Kind sinnvoll ist und wann eine Geburt eingeleitet werden sollte.
Das Erste, was ich Frauen bei Beginn einer Betreuung sage, ist: »Dir gehört dein Mutterpass. Es ist dein Körper und deine Schwangerschaft. Du selbst kannst bestimmen, was du möchtest, du kannst alles in Frage stellen und dir uns als Hilfe dazuholen.« Ich kläre sie über die Empfehlungen der Mutterschaftsrichtlinien und später über mögliche Geburtskomplikationen auf. Dieses Wissen trägt dazu bei, dass die Frauen nicht aus Angst alles mit sich geschehen lassen, sondern mündig entscheiden können, welche Untersuchungen sie in Anspruch nehmen.
Die Hebammenbegleitung über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist eine Weise, Bürokratie zu umgehen. Kliniken und Ärzte halten sich eher ans technische Abklären von Daten – -Hebammen arbeiten mit Nähe, und daraus entsteht Sicherheit. Es ist eine intensive Betreuung, bei der Hebamme und Mutter sich miteinander vertraut machen und wissen, dass sie füreinander ansprechbar sind. Daraus entsteht meist für alle Beteiligten eine satte Zufriedenheit, selbst wenn nicht alle Phasen komplika-tionslos verlaufen. Eine Hausgeburt zu begleiten heißt, immer wieder nach dem Wohlergehen von Mutter und Kind sowie nach dem Geburtsfortschritt zu sehen. Weil alle Beteiligten im Prozess so miteinander eingeschwungen sind, ist es möglich, auch mal von Vorgaben abzuweichen. Bei der Betreuung im Wochenbett gehen die vorgegebenen 35 Minuten pro Hausbesuch an der Realität vorbei. Es ist eine sehr sensible Zeit, in der Mutter und Kind einen sicheren Rahmen brauchen. Wenn eine fremde Person einfach hastig ins Zimmer kommt, um kurz mal medizinische Werte zu checken, kann das viel kaputtmachen. Oft finde ich mich in Situationen wieder, die sich eher nach familientherapeutischer Arbeit anfühlen. Dann fließen auch mal Tränen – und am Ende hat sich auch die Brustentzündung verändert.
Isabel Renninger ist Hausgeburtshebamme und gründet zur Zeit mit vier weiteren Frauen ein Geburtshaus in Flensburg, getragen vom Verein »Familien zwischen den Meeren«.

Anne
Als wir uns vor knapp zwanzig Jahren entschlossen haben, gemeinsam zu leben und zu arbeiten, mussten wir feststellen, dass es keinen offiziellen Rahmen gibt, der zu unserer kollektiven Idee passt. Es stehen nur verschiedene Konstrukte zur Auswahl: Wir können Vereine gründen, GmbHs aus dem Boden stampfen, uns mit Genossenschaften beschäftigen oder als Einzelunternehmen tätig werden. Für alles sind diverse Kontrollen, Steuererklärungen, Protokolle, Versicherungen und eine fast unendliche Liste an Aufgaben und Dokumentationen nötig. Alle Varianten, die uns zur Verfügung stehen, haben ihre Nachteile und manchmal auch einige Vorteile. Aber sie passen nicht wirklich zu unserem Leben.
Wir sind ein Kollektiv mit landwirtschaftlichem Betrieb, einer kleinen Weiterverarbeitung und einem gemeinnützigen Verein. Weiter sind wir mit einem Bioladenkollektiv in Berlin verbunden. Daraus ergibt sich ein riesiger Berg an bürokratischem Aufwand, der dazu führte, dass wir einen Wohnraum zugunsten der Aktenordner aufgegeben haben: unser Büro, ohne das wir uns ein Leben nicht mehr vorstellen können.
Eine ökologische Landwirtschaft zu betreiben, bedeutet, viele Listen zu führen, Anträge zu stellen und jedes Handeln täglich zu notieren. Das ist nicht übertrieben. Alle Arbeiten, jeder Warenfluss, jede kleine Verletzung und das benötigte Pflaster sollten dokumentiert werden, um von Sanktionen verschont zu bleiben.
Wir haben uns dafür entschieden, uns mit der Büroarbeit abzuwechseln, anstatt zwei Personen zu finden, die sich hauptsächlich mit diesen Aufgaben beschäftigen. Dadurch konnten alle die verschiedenen Bereiche aus bürokratischer Sicht kennen-lernen und damit manche seltsame Handlung oder Vorgabe besser verstehen. Die ganze Kacke kostet uns nicht nur Lebenszeit, sondern auch Geld! Unsere Löhne stehen in keinem Verhältnis zu dem, was wir für Bauanträge, anwaltliche und notarielle Tätigkeiten, das Steuerbüro und Ähnliches ausgeben. Wir stellen uns immer wieder die Frage, wie lange wir dieses System noch bedienen wollen. Wir sehnen uns nach Zeiten, in denen wir autonom gehandelt haben, gebaut haben, was und wo wir wollten; in denen wir Leute bekocht haben, wenn wir Lust dazu hatten; in denen wir Feste feierten und Freizeit hatten, die wir oft nutzten, um dem ganzen bürokratischen Konstrukt etwas entgegenzusetzen.
Das Hofkollektiv Bienenwerder bewirtschaftet seit 2004 einen Vierseithof im märkischen Oderland bei Müncheberg, östlich von Berlin.

Maria Jou Sol
Das »Haus des Wandels« ist ein Raum für Kunst und Lernen, ein postlokaler Dorfplatz – 3000 Quadratmeter umbauter Raum einer ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsberufsschule mit Internat. Als Grundbesitzer und immer wieder auch Fördernehmer von Projektgeldern auf EU-, Landes- und kommunaler Ebene haben wir viel mit der Arbeit an bürokratischen Schnittstellen zu tun. Rechtsformen, die wir bedienen, sind zwei Vereine – der eine gemeinnützig, der andere nicht. Alle in unserer Gruppe müssen sich darüber klar sein, dass sie jetzt Hausbesitzende sind. Das ist auch eine Frage von Sorgearbeit.
Wenn du an Anträge oder Projektabrechnungen mit der Haltung »das ist eine Queste, eine Abenteuer-geschichte« rangehst, dann kannst du fast gar nicht daran scheitern: Du bekommst eine Liste, die du abarbeiten musst wie in einem Märchen oder einem Computerspiel. Du darfst dich nicht aufregen, wenn immer noch eine Forderung kommt, sondern musst dich in eine hiobmäßige Hingabe begeben: »Was wollt ihr noch? Welche Geschichte braucht ihr noch?« Es hilft, sich gegenüber dieser Staatsgewalt nicht auf die wirkliche Ebene zu begeben, sondern in der Geschichte zu bleiben, als Parzival. So betrachtet, ist das eine Performance, die mensch abliefert, etwa mit der Art und Weise zu kommunizieren. Gefährlich wird es, wenn wir beides nicht mehr auseinanderhalten können: diese Rolle und die Wirklichkeit der Gruppe. Beim Schauspielen ist genau das die Aufgabe.
Bürokratiearbeit aushalten zu können, hat auch mit Privilegien zu tun. Wenn der Fensterchenbrief auf deinem Schreibtisch liegt, dann ist das staatliche Gewalt, die dich direkt betrifft. Je nachdem, ob du als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass das existenzbedrohend ist oder nicht, werden dabei Gefühle angestoßen. Das emanzipatorische Moment daran kann sein, Menschen, die weniger privilegiert sind, zu ermächtigen, dass sie keine Angst vor dieser Staatsgewalt haben müssen.
Es ist nicht möglich, unser Projekt lebendig zu halten und die Schnittstelle als etwas zu sehen, das unabhängig davon als etwas Unlebendiges existieren kann. Wir müssen die Bürokratie selbst queeren: etwas erfragen, das außerhalb der Norm liegt, auf etwas beharren. Auch Sachbearbeitende gehen menschliche Beziehungen ein – »No mercy with the state, but love to the Sachbearbeiter*in!«
Muerbe u. Droege (MuD) sind als Kollektiv die »Künstler*innen vom Dienst (KvD)« im »Haus des Wandels« (HdW) in Ostbrandenburg.

Alexandra Scherf
Eines Abends saß ich als Gemeinderatsmitglied mal wieder im Gemeinderat mit neun Männern zusammen. Die einzige anwesende Frau war die Protokollantin. Am Anfang des Treffens schlug ich eine Mappe auf, die ich eigens dafür vorbereitet hatte, und fing an, scheinbar daraus vorzulesen. Ich sei auf ein Beispiel aus der Presse gestoßen. Dort sei von einem Gemeinderat berichtet worden, in dem nur Männer vertreten seien und die einzige Frau das Protokoll schreibe. Die Männer hätten festgestellt, wie unangemessen es sei, dass die Interessen der Gemeinde nur von älteren Herren vertreten würden, und deshalb beschlossen, dass sich diese Vertretung besser aus einer diverseren Personengruppe zusammensetzen sollte. Sie hätten also die Frauen des Dorfs eingeladen, ihnen neun Frauen an die Seite zu stellen. So wurden junge und alte Frauen geschickt, die mit ihren Ideen und Bedenken die Gemeinde unglaublich bereicherten. Die sei so erfolgreich, dass bald die Presse aufmerksam wurde, andere Gemeinden sich ein Beispiel nahmen und der Ministerpräsident ihnen gratulierte.
Langsam begriff mein Gemeinderat, dass ich nicht aus einem tatsächlichen Zeitungsartikel vorlas, sondern über unsere Situation sprach. Alle sackten in ihren Stühlen zusammen und die Protokollantin fing an zu grinsen. Ich redete dann offen darüber, dass ich mir so einen Prozess in unserer Gemeinde wünsche und bei der nächsten Sitzung gerne darüber sprechen würde.
Schon am nächsten Tag bekam ich einen Anruf vom damaligen Bürgermeister: »Ja, Thomas, wie stellst du dir das denn vor? Das wären ja dann also quasi Menschen im Gemeinderat, die gar nicht ordentlich gewählt worden sind. Das ist nicht durch die Kommunalaufsicht abgedeckt. Das geht doch nicht!« Ich fragte ihn, ob er denn nicht Wege dafür in der Kommunalordnung sähe, er kenne diese ja viel besser als ich. Tatsächlich fand er die Möglichkeit, einen Ausschuss zu gründen – was wir dann auch taten. Im Ausschuss für »nachhaltiger Entwicklung« wirken heute Frauen, junge Menschen und die Ältesten des Dorfs an Themen, die wir sonst im Gemeinderat nicht bewegen: »Wie können Menschen würdevoll im Ort alt werden?«, »Wie kann die Mobilität verbessert werden?« Das empfanden die Ratsherren durchaus als Bereicherung.
Thomas Meier lebt in der Gemeinschaft Schloss Tonndorf und wurde 2016 in den Gemeinderat von Tonndorf gewählt.

Magdalena Neubig
Die »Poliklinik Veddel« existiert seit 2017 in Hamburg. Dort arbeiten viele verschiedene Leute zusammen, unter anderem Ärztinnen, Psychologen und Juristinnen. Wir beraten Menschen zu Fragen in allen Lebensbereichen und helfen im Umgang mit Ämtern. Ich arbeite seit drei Jahren in der Poliklinik und mache soziale Beratung. Außerdem leite ich das »Romani Kafava«, ein Beratungscafé für Romnija und Roma. Dieses Angebot nehmen vor allem Familien oder alleinerziehende Mütter wahr. Manchmal kommen sie mit kranken Kindern, manchmal wegen Schwierigkeiten mit dem Jobcenter oder bei der Wohnungssuche. Neben solchen Beratungen leiste ich vor allem Übersetzungsarbeit, denn viele haben Probleme, die Informationen und Formulare in einer für sie noch fremden Sprache zu verstehen. Neben Romanes und Deutsch spreche ich Montenegrinisch, Französisch, Albanisch, Italienisch und Serbisch sowie Gebärdensprache in Montenegrinisch und Albanisch. Manchmal bekomme ich auch Anfragen von Menschen aus anderen Ländern, wie dem Kosovo oder Frankreich, und vermittle ihnen Kontaktadressen vor Ort.
Ich selbst bin Kosovarin und in Montenegro aufgewachsen. 1991 war ich wegen des Jugoslawienkriegs gezwungen, zusammen mit meinem Mann und damals zwei Kindern nach Deutschland zu flüchten. Hier wurden meine anderen sechs Kinder geboren. Es ist mir wichtig, dass sie in die Schule gehen, inte-griert werden und ein gutes Leben führen können. Nach 14 Jahren mit Duldungsstatus wurden wir als Familie abgeschoben. Wir lebten einige Jahre in Italien, Frankreich und Belgien, bevor wir ein zweites Mal nach Deutschland kamen. Noch heute werde ich traurig, wenn ich daran denke.
Frankreich war das erste Land, in dem wir Hilfe von solidarischen Gruppen bekamen. Da wurde mir bewusst, wie viele Menschen in einer Notlage sind. Als ich dann nach Deutschland zurückkehren konnte, wollte ich Menschen durch Übersetzungs- und Beratungsarbeit helfen. Ich habe verschiedene Leute auf Ämter und in Kliniken begleitet. Für Menschen ohne Dokumente war und ist es schwierig dort. Als ich in die neu eröffnete Poli-klinik kam und dort hörte: »Ja, wir nehmen Menschen auch ohne Papiere auf«, habe ich vor Freude geweint. Diese unbürokratische Hilfe wird so dringend gebraucht!
Zumreta Sejdovic berät Menschen in der »Poliklinik Veddel«, einem -sozialen Stadtteil-Gesundheitszentrum in Hamburg.

Hannes Thierbach
Wir sind 1997 als erweiterte Großfamilie ins ostvorpommersche Dorf Klein Jasedow gezogen. Ein junger Mann, der schon in Bayern zur Gemeinschaft gehörte, wollte sich ursprünglich ums Fundraising kümmern. Wegen eines familiären Schicksalsschlags fiel er von heute auf morgen dafür aus. Ich selbst als Musikerin hielt mich für denkbar ungeeignet – doch wir waren in Not: Wir standen vor Ruinen und wollten hier die Vision eines lebendigen Lernorts – eines Zentrums für Schönheit, Musik und Tanz – Wirklichkeit werden lassen. Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Die Kraft, die ich damals aufgebracht habe, war wie eine Woge, in die ich mich einfach hineinwarf. Damit nahm ich die von meiner Profession recht entfernten Arbeiten auf: die Kontakte zu den Behörden hüten, Anträge stellen sowie nachbohren und hinterfragen, wenn diese abgelehnt wurden − ich habe mir ein Ohr abtelefoniert!
In den ersten Jahren habe ich das sicher sehr ungeschickt gemacht. Aber ich fand Menschen, bei denen ich mich fortbilden konnte, nahm an einer Fundraisingtagung teil und ging zu Infoveranstaltungen von Stiftungen. Dabei hatten wir teils schwierige Startbedingungen: Viele Menschen in der Region hatten nach der Wende schlechte Erfahrungen mit Westdeutschen gemacht, und in den ersten Jahren erfuhren wir häufig großes Misstrauen. Ein Antrag für unser »Klanghaus am See« wurde abgelehnt. Damals war ich entmutigt und traurig darüber, dass ich mich über Jahre erfolglos bemüht hatte. Dann habe ich mich von den hiesigen Stellen unabhängiger gemacht, Förderanträge bei überregionalen Stiftungen gestellt und mich auf unsere persönlichen Netzwerke aus der Musik besonnen – mit Erfolg.
Ich blieb aber, wo es Not tat, an regionalen Institutionen dran und habe etwa die Stellen, die uns als Jugendhilfeträger und als freier Träger für Weiterbildung abgelehnt hatten, beharrlich wie ein Maulwurf, der in der Erde gräbt, immer wieder kontaktiert. Im Lauf der Jahre wandelte sich die Stimmung in den Ämtern. Stellen wurden zum Teil mit aufgeschlosseneren Leuten besetzt, und heute pflegen wir gute Kontakte zu etlichen Menschen, die in Behörden arbeiten. Was mich damals getragen hat, war unsere Gemeinschaft. Ich habe alles aus einem »Wir« heraus getan.
Christine Simon begann vor 25 Jahren, Schnittstellen der Lebens-gemeinschaft Klein Jasedow zu hüten.

Vanda Perez Bessone
In unserem Naturkindergarten in Köln müssen wir uns mit juristischen Feinheiten etwa bei der Hygiene oder im Arbeits- oder Kinderschutz auseinandersetzen. In den letzten zwei Jahren war es für uns immer wieder eine Herausforderung, die Bedürfnisse aller unter einen Hut und mit den geforderten Corona-Maßnahmen in Einklang zu bringen. Ständig kamen neue Bestimmungen von außen, und wir mussten uns wieder umstellen. Am Anfang des Lockdowns durften nur solche Eltern ihre Kinder bringen, deren Berufe als »systemrelevant« galten. Später mussten die Eltern ein Formular bei uns abgeben, auf dem sie unterschrieben, dass sie keine anderen Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Diese Selbsterklärungen mussten wir kontrollieren. Alles in mir weigerte sich, diese Rolle zu übernehmen, weil sich dadurch etwas zwischen uns und die Eltern schob.
Viele Kitas machten Eltern Druck, die Kinder andernorts zu betreuen oder sie nur zweimal in der Woche zu bringen. Als wir eine Runde am Feuer machten, wurden die Bedürfnisse und Wünsche des Teams deutlich: Wir wollten für die Kinder da und gleichzeitig geschützt sein und Kontakte möglichst reduzieren. Wenn wir alle Kinder einladen würden zu kommen und wir sie nur im Außenbereich betreuten, wären sowohl die Infektionsgefahr als auch die Anzahl der Kontakte reduziert. Ansonsten hätten viele Kinder mehrmals pro Woche zu verschiedenen Betreuungspersonen gebracht werden müssen. Also entschlossen wir uns, alle Kinder zu betreuen, aber draußen – und da es mitten im Winter war, nur sechs Stunden, statt der vorgegebenen sieben. Auf einmal erschien uns das der verantwortungsvollste Weg, obwohl die Verwaltung ein anderes Vorgehen forderte. Entscheidend im Kontakt mit den Behörden war für uns, der Situation mit cleveren Methoden und Vertrauen zueinander zu begegnen, spielerisch Lösungen zu finden, die für alle stimmig sind, und gemeinsam das Risiko zu tragen.
Vanda Perez Bessone wuchs in Argentinien auf. In zwei Naturkindergärten, die sie mitgegründet hat, integriert sie die Prinzipien von Selbst-organisation, Commons und Gewaltfreiheit.

Christoph Strünke
Ich koordiniere beim Ökodorfnetzwerk GEN das Projekt »Trans-regio«, welches vom Umweltbundesamt gefördert wird. Dazu gehört es, die Fäden zusammenzuhalten und die Übersicht zu behalten. Ein anderer Teil ist die Verwaltungsarbeit: Berichte an Ämter schreiben, Abrechnungen machen und organisieren, dass Überweisungen getätigt werden.
Was mir hilft, lebendig zu sein, ist die Abwechslung zwischen Büroarbeit, dem Zusammentreffen im Team und der Durchführung der verschiedenen Projekte. Es tut gut zu sehen, wofür ich diese Arbeit mache, und aktiv Teil davon zu sein. Zum Beispiel fahre ich im Sommer für drei Wochen mit auf einer sechswöchigen Radtour, die im Rahmen des Transregio-Projekts stattfindet. Ich rufe mir auch immer wieder in Erinnerung, dass meine Arbeit Nischen ermöglicht. Außerdem tut es mir gut, zum Beispiel im Forum unserer Gemeinschaft von meiner Arbeit zu erzählen und damit gesehen zu werden; aber besondere Wertschätzung brauche ich nicht, um diese Arbeit gerne zu machen.
Manchmal ist die Diskrepanz zwischen Förderantrag und Realität eine Herausforderung. Während der Corona-Zeit musste ich zum Beispiel einen Antrag dreimal verändern und Geld in der Finanzplanung verschieben. Das nervt, aber in gewisser Weise ist es auch ein kreativer Akt, bei dem ich zusammen mit anderen Menschen Lösungen suchen muss. Ich bin auch ganz gut geeignet für den Job, weil ich auch dann gern auf die Leute zugehe, wenn sie zum Beispiel noch eine Rechnung einreichen müssen. Ich bin dann geduldig, weil ich weiß, dass solche Tätigkeiten nicht allen leichtfallen.
Hilfreich ist auch, dass die Zuständige beim Umweltbundesamt eine Person ist, die selbst kreativ ist und uns toll findet. Ich telefoniere alle drei Monate mit ihr und fühle mich in der Zusammenarbeit wohl.
Zu meiner Tätigkeit gehört es auch, viele Tabellen auszufüllen. Ich bin ein Strukturliebhaber und jongliere gern mit Zahlen. Wenn in einer Tabelle 30 Euro fehlen, dann begebe ich mich auf Spurensuche und verbringe eine halbe Stunde damit, den Fehler zu finden, weil ich weiß, dass es für das gesamte Projekt wichtig ist. Daraus beziehe ich meine größte Kraft.
Christoph Strünke lebt seit 20 Jahren im Ökodorf Sieben Linden. Er liebt Permakultur und Percussion.

Michael Jedamzik
Ich arbeite in der Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf auch für unseren Verein. Hätte mich früher jemand gefragt, ob ich einmal so einen Bürojob machen würde, hätte ich das verneint! Jetzt bin ich quasi geschäftsführend in unserem Verein tätig, ohne im Vorstand zu sein, da wir eher lose im Team organisiert sind. Manchmal bespreche ich Anliegen mit dem Vorstand, aber alles Wichtige kommt ins Plenum.
Wir versuchen immer, miteinander Lösungen zu finden, die den Menschen und unserer Vision dienen. Die Verwaltung soll uns dienen und nicht wir der Verwaltung, daher stellen wir uns immer wieder die Fragen »Warum machen wir das? Wofür ist es gut – und: Brauchen wir das?« An den Schnittstellen kann auch Gestaltungsmacht entstehen, wenn es etwa darum geht, an welchem Bauantrag zuerst gearbeitet wird. Daher ist es wichtig, dass die anderen denen, die verwalterische Aufgaben übernommen haben, vertrauen – auch weil für manche Entscheidungen viel Wissen notwendig ist, um an der Schnittstelle handlungsfähig zu sein. Einige Menschen wollen sich nicht mit der Verwaltung beschäftigen oder meinen, dazu nicht fähig zu sein. Sie bringen dann an anderen Stellen Kompetenzen ein.
In unserer Gemeinschaft ist es uns wichtig, einen individuellen Umgang mit Tätigkeiten und Bedürfnissen zu pflegen. Wir entscheiden situativ, statt uns mit großen Regelwerken einzuengen. Zum Beispiel wollte jemand eine Brennholzkasse für die Sauna einführen, weil er Saunieren für verschwenderisch hielt. Aber was wäre dann mit anderen Gemeinschaftsräumen, die geheizt werden, ohne dass alle sie nutzen, was mit unterschiedlichen Wohlfühltemperaturen oder Duschgewohnheiten? Wir müssten anfangen, jedes Holzscheit zu zählen, aufzuschreiben, abzurechnen. Das wäre eine enorme interne Verwaltung, auf die niemand Lust hat. Also entschieden wir uns, darauf zu vertrauen, dass wir alle sparsam und bedürfnisorientiert heizen.
Ich bin in die Verwaltungsarbeit hineingewachsen, weil sie mir leichtfällt und weil sie notwendig ist. Es ist toll zu sehen, welche Projekte durch Schreibtischarbeit ermöglicht werden. Als Ausgleich zur Büroarbeit koche ich oder backe Brot für die Gemeinschaft.
Lea Hinze hat die Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndorf 2005 mitbegründet und lebt dort mit ihren Kindern. Sie berät und begleitet auch andere Gemeinschaften und Gründungsgruppen.

women-in-exile.net
Derzeit sind wir 25 aktive Frauen, die sich alle zwei Wochen in einer Strategiegruppe treffen und Aktionen planen. Wir sind ehrenamtlich und ohne rechtliche Organisationsstruktur tätig. Einmal im Monat trifft sich ein größerer, eher loser Kreis von etwa 45 engagierten Frauen. 2011 haben wir außerdem einen Verein gegründet, der sich »Women in Exile & friends« nennt. Neben uns geflüchteten Frauen engagieren sich hier auch Menschen, die keinen Fluchthintergrund haben und beispielsweise bei der Begleitung von Amtsgängen und bei Übersetzungen helfen.
Initiiert wurde unsere Gruppe von Frauen, die in einem Flüchtlingslager in Brandenburg untergebracht waren. Sie haben erlebt, dass sich niemand um die schlechten medizinischen und hygienischen Bedingungen in den Lagern kümmerte und dass es keinen Schutz vor gewalttätigen Übergriffen gab. Sie haben erkannt, dass ihnen niemand helfen wird, wenn sie nicht anfangen, über ihre Probleme zu sprechen und für ihre Rechte zu kämpfen. Einige Gründerinnen sind heute immer noch Teil der Initiative, und es gibt es immer wieder neue Frauen, die sich einbringen.
Wir sehen uns selbst als Brücke für geflüchtete Frauen, damit sie in dieser Gesellschaft einen guten Platz finden. Wir haben die Kampagne »Kein Lager für Frauen und Kinder« begonnen und helfen, Frauen und ihre Kinder aus Lagern herauszubekommen. Dafür arbeiten wir mit Menschen an solidarischen Orten zusammen, an denen sie unterkommen können. Wir versuchen, Frauen zu ermutigen und zu befähigen, in dieser Gesellschaft ihre Rechte einzufordern und aus der Isolation herauszukommen. Außerdem organisieren wir Aufklärungs- und Bildungsarbeit mittels Workshops, Blogs und eines Gesundheitsmagazins zu den Themen Diskriminierung, Rassismus, Gesundheitsfürsorge und Rechte. Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens geben wir ein kollektiv geschriebenes Buch heraus und bereiten eine internationale Frauenkonferenz vor. Einerseits können sich dort Frauen, die als Geflüchtete in anderen Ländern leben, austauschen und vernetzen; andererseits werden wir uns mit den politischen, wirtschaftlichen und kolonialen Ursachen von Zwangsvertreibung auseinandersetzen.
Halima Farah ist Aktivistin bei »Women in Exile«, einer Initiative geflüchteter Frauen, die sich 2002 in Brandenburg gründete.

Kante*
Wir sind »KanTe«, das Kollektiv für angepasste Technik. Die Gründungsmitglieder hatten sich 2014 am Ende oder nach dem Studium der Umwelttechnik zusammengefunden. Verwaltungsstrukturen haben wir nicht mehr als nötig. Wir erstellen eine Liquiditätsplanung fürs laufende Jahr, checken quartalsweise unsere Finanzen und reden darüber, ob wir etwas ändern müssen. Manche arbeiten hauptsächlich im Kollektiv, andere haben noch andere Anstellungen. Wir ermutigen einander, unsere freie Struktur guten Gewissens zu nutzen, anzumelden, wie viel Geld wir für unser jeweiliges Auskommen benötigen, und dies über die Einnahmen aus unseren Tätigkeiten zu decken. Für dieses vertrauensvolle Miteinander ist es förderlich, dass unser Kollektiv aus einem bestehenden Freundeskreis heraus entstanden ist. In den letzten Jahren gab es auch Austritte, weil manche Bedürfnisse im Kollektiv nicht gedeckt werden konnten. Das konnten wir ohne Streit miteinander besprechen.
Derzeit sind wir im Kern vier Frauen und arbeiten überwiegend zu den Schwerpunkten »Bauplanung« und »alternative Sanitärsysteme«. Büro- und Öffentlichkeitsarbeit sind in Arbeitsgruppen unter uns aufgeteilt. Vernetzt mit anderen Kollektiven und Hausprojekten arbeiten wir auch an der gesellschaftlichen Aufklärungsarbeit über Trocken-toiletten und zur Frage, wie wir im Alter leben wollen.
Beim Begriff »Verwaltungslogik« habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Leute sich mehr darin gefangen fühlen, als es nötig wäre, und manchmal in einer Art vorauseilendem Gehorsam Spielräume nicht nutzen – aus Angst, gegen etwas zu verstoßen oder andere Nachteile zu haben. Es ist, als wäre die Kreativität, die wir an den Tag legen, nicht rechtens. Das erleben wir im Kollektiv wie auch auf den Baustellen. Es gibt zwar DIN-Normen, sie sind aber nicht in jedem Kontext bindend. Beispielsweise können Regelungen zum Schallschutz in einem Hausprojekt nach den Bedürfnissen der dort Wohnenden gestaltet werden. Es gibt kein Amt, das dabei etwas vorschreibt. Ich sehe Strukturen als Klettergerüst, an dem ich mich festhalten kann, solange ich es brauche. Wenn ich mich selbst nicht gut genug auskenne, können Normen und Regelungen hilfreich sein. Ich versuche, Strukturen eher als ein Angebot zu betrachten, das ich nutzen kann, als etwas, das mir übergestülpt wird.
Corinna Holzgreve ist Mitglied des Kollektivs »KanTe«, das sie vor acht Jahren mitgegründet hat.

Robin Dirks
Wir sind wohl eine der am besten strukturierten Kommunen. Basis der Kommunestruktur ist ein Grundsatzpapier. Es beschreibt eher Werte, an denen wir uns orientieren, statt konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Daneben haben wir eine gut funktionierende Tradition, formale Entscheidungen im Konsens zu treffen und sie niederzuschreiben. Damit schaffen wir für uns ein System, bei dem sich Recht aus vorherigen Entscheidungen bildet. Gleichzeitig ist klar, dass diese Entscheidungen auch ein Verfallsdatum haben. Wenn etwas nicht mehr gelebt wird, dann erlischt die Bindungswirkung. Viele Entscheidungen bilden Einzelfälle ab und haben schon dadurch nur eine begrenzte Dauer.
Generell empfinde ich es so, dass Strukturen eher erst Lebendigkeit ermöglichen. Dadurch, dass gewisse Sachen geregelt sind, binden sie keine Ressourcen. Ich glaube, dass uns das überhaupt erst ermöglicht, zu sechzigst zusammenzuleben und Lebens-bereiche miteinander zu teilen, die andere überfordern würden. Wenn viele Dinge vage bleiben, weil keine Struktur dafür geschaffen wurde, durch die sie konkret werden, kann das sehr aufreibend sein. Unsere Regeln sind so beschaffen, dass sie Ausnahmen schon mit vorsehen. Beispielsweise ist jede Person gleich oft mit Kochen oder Spülen dran, aber es ist überhaupt nicht wichtig, wann genau das ist, und es wird wild getauscht.
Staatliche Strukturen sehen den Sonderfall – eine sechzigköpfige Kommune, die eine Einkommensgemeinschaft bildet – nicht vor. Da müssen wir als Verwaltungskollektiv kreative Übersetzungsarbeit leisten. Von einem Rechtsanwalt haben wir gelernt, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was wir machen, sondern wie wir es rechtlich interpretieren. Was aus einer Betrachtungsweise illegal sein kann, kann aus einer anderen Betrachtungsweise völlig legal sein. Die legale Weise sollte dann aktenkundig und damit zu einem Faktum für Juristen werden.
Als Kommune gönnen wir es uns, dass Menschen die Verwaltungsarbeit hauptamtlich machen. Für die meisten Aufgaben, die wir als Verwaltungskollektiv übernehmen, sind die Leute dankbar. Da funktioniert die Arbeitsteilung bei uns gut.
Gunter Kramp und Marcus Bechtel sind Teil eines Sechserteams, das die Verwaltungsarbeit in der Kommune Niederkaufungen hütet.

Lars Kaiser
Ich arbeite im »Konzeptwerk Neue Ökonomie« in der Gesamt-koordination, bereite Plena vor, arbeite an der Schnittstelle mit dem Jobcenter, stelle Arbeitsverträge aus, bin im Kontakt mit der Krankenkasse, kümmere mich um betriebliche Altersvorsorge und bin für Verträge verantwortlich.
Ich habe eine dreijährige Ausbildung im Bürokratiewesen und mag es, an dieser Schnittstelle tätig zu sein, weil ich dort einen Bereich habe, in dem Aufgaben klar abgeschlossen werden können. Es gibt manche Verwaltungsaufgaben, in denen ich Sinn sehen kann, aber auch eine Menge, die ich einfach als Zeitverschwendung empfinde. Ich frage mich oft, wer denn eigentlich die ganzen Berichte und Zwischenberichte der Fördermittel-anträge liest. Ich bin auch im konzeptuellen Bereich tätig und diesen Ausgleich schätze ich. Wir haben im Konzeptwerk ein Auge darauf, dass Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, auch inhaltlich tätig sind. Wir machen diese unsichtbarere Arbeit, ohne die nichts laufen würde, sichtbar und zeigen in unseren Treffen unsere Wertschätzung dafür. Wenn wir wissen, dass Menschen etwa wegen eines Fördermittelantrags unter Druck stehen, versuchen wir, sie durch kleine Aufmerksamkeiten, Mitbringsel vom Bäcker oder humorvolle Gesten darin zu unterstützen, raus aus dem Stress zu kommen. Manchmal scheitern wir auch daran, und jemand muss alleine abends noch etwas fertigstellen, weil eine Frist abläuft.
Das Verwaltungsdenken sickert besonders im Bereich der Finanzen durch und kann Druck aufbauen, denn die Menschen, die diese Schnittstelle hüten, haben eine Übersicht über die Finanzen und fühlen sich verantwortlich dafür, dass alle Mitglieder des Kollektivs Honorare erhalten. Unsere heftigste Situation war bei der »Degrowth Sommerschule 2016«, als ein Förderer absprang, und uns plötzlich 40 000 Euro fehlten. Wir hatten großes Glück, dass befreundete Netzwerke uns durch Crowdfunding dabei helfen konnten, das Geld gemeinsam aufzutreiben.
Charlotte Hitzfelder arbeitet beim »Konzeptwerk Neue Ökonomie« in Leipzig. Das Kollektiv aus rund 30 Menschen ist in der politischen Bildungsarbeit tätig und vernetzt soziale Bewegungen.

Robert Strauch
Das Thema dieser Ausgabe hat auch viel mit der Verfasstheit von Oya selbst zu tun. Die Zeitschrift wird ermöglicht und getragen von der Oya Medien e G, die derzeit 570 Mitglieder hat.
Mit Hilfe von Genossenschaftsanteilen und viel Vorschussvertrauen konnte die erste Ausgabe im März 2010 erscheinen und die erste Druckrechnung bezahlt werden. Auch danach reichten die Einnahmen trotz viel geschenkter Arbeitszeit nicht aus, um die Kosten zu decken. Das anfangs entstandene Defizit konnte Oya nie wieder ausgleichen. Um dauerhaft Überschüsse zu erwirtschaften, hätten viel mehr Menschen Oya abonnieren müssen, doch die Zahl der Abos hat sich relativ konstant bei rund 4000 eingependelt.
Auf diese Situation reagierten wir, indem wir 2017 den -Hütekreis gründeten. Dieser finanziert seither zumindest teilweise den Lebensunterhalt der Redaktionsmitglieder, so sie ihn nicht anderweitig erwirtschaften. Die derzeit 327 Hütenden tragen auch inhaltlich und organisatorisch bei und begleiten Oya auf dem Weg vom Produkt zum Commons. Die laufenden Kosten werden also mittlerweile durch Abonnements und Hütekreisbeiträge gedeckt; doch das mitgeschleppte strukturelle Defizit können sie nicht beheben. Das wurde uns vom Prüfungsverband vorgeworfen: Oya darf nicht dauerhaft defizitär sein, sondern muss den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Mitglieder mehren; denn das ist das Wesen einer Genossenschaft. Wir schrieben dem Verband, dass der Mehrwert bei Oya ein ideeller ist und die Mitglieder das Projekt und seine Inhalte unterstützen wollen. Doch das ist in dieser Rechtsform nicht vorgesehen.
Was also tun? Seit einem Jahr versuchen wir in intensiven Denkprozessen, die Rechtsform der Realität anzupassen. Ob wir etwa zusätzlich einen eingetragenen gemeinnützigen Verein gründen oder die Oya Medien e G in eine gemeinnützige Genossenschaft umwandeln, um steuerbegünstigt Spenden annehmen zu dürfen – darüber diskutieren wir im Vorstand, im Aufsichtsrat und mit den Genossenschaftsmitgliedern. Eines zeichnet sich dabei schon ab: früher oder später werden wir unsere Genossenschaftsmitglieder um Geschenke bitten – das ist in dieser Rechtsform zwar auch nicht vorgesehen, aber möglich. Vielleicht kann das ein weiterer Schritt hin zu einer Oya-Schenkökonomie sein. Was denken Sie, was denkt ihr als Oya-Lesende dazu?
Andrea Vetter ist Mitglied im Oya-Redaktionskreis und seit 2021 gemeinsam mit Lara Mallien im Vorstand der Oya Medien e G.
weitere Inhalte aus #68 | Schnittstellen hüten