Frauen für den Frieden
Seit dem Ende der Jugoslawienkriege wirken Frauen in den betroffenen Ländern als Kondensationskerne für friedlichen Wandel.

Im Herbst 1992, als ich während meines Studienjahrs in den USA den Antrag für einen kalifornischen Führerschein ausfüllte, ging es mir ähnlich wie vielen Menschen heute, wenn sie Post von ihrer Krankenkasse erhalten: Ich wurde aufgefordert, mich zu meiner Haltung zur Organspende zu äußern, indem ich einen beigefügten roten Klebepunkt an entsprechender Stelle anbrachte: Spender – Nicht-Spender. Damals war ich zunächst überrascht, doch dann angetan von dieser Aufforderung. Von der Möglichkeit der Organspende hatte ich schon gehört, doch mich noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt. Ich überlegte, wie ich dazu stehe, meinen Körper nach meinem Tod – so hieß und heißt es ja – zu einer Organentnahme zur Verfügung zu stellen. Den Gedanken an eine solche Operation an meinem Leichnam fand ich nicht schön, aber Berichte von Nahtoderlebnissen hatten mich zu der Überzeugung gebracht, dass mein Körper nach meinem Tod für mich nicht mehr von Bedeutung sein wird. Und wenn dadurch das Leben anderer Menschen gerettet werden konnte? Meine Entscheidung war klar: Spender.
Viele Jahre später wurde ich durch meine Arbeit an einem Forschungsprojekt zur Transplantationsmedizin in Deutschland erneut mit dem Thema konfrontiert. Erst da wurde mir klar, was ich alles bei meiner damaligen Entscheidung nicht gewusst hatte, was ich an Informationen gebraucht hätte, um wirklich »aufgeklärt« zu entscheiden, und was im Falle eines Falles auf mich bzw. meine nächsten Angehörigen zugekommen wäre.
Heute – zwei Jahrzehnte nach meinen ersten Begegnungen damit – ist die Transplantationsmedizin ein etabliertes medizinisches Verfahren. Viele schwerstkranke Menschen konnten mit ihr dem nahen Tod entrinnen oder deutliche Erleichterung in ihrem Leiden erfahren. Über Organspende ist häufig in den Medien zu hören, und doch bleiben die Informationen oberflächlich, erfährt man selten etwas über die strittigen Aspekte im Kontext Transplantationsmedizin oder die Auswirkungen einer Organübertragung auf die Spender, ihre Angehörigen und die Organempfänger.
Organtransplantationen berühren Grundfragen der menschlichen Existenz. Was macht einen Menschen aus: primär seine kognitiven Fähigkeiten und sein Potenzial als eigenständig handelndes Individuum – oder auch seine leib-seelische Präsenz auf dieser Welt? Wie hängen Körper und Identität eines Menschen zusammen? Wann ist ein Mensch tot: erst wenn er sich im herkömmlichen Sinn in eine Leiche verwandelt hat – oder schon bei irreversiblem Versagen seines Gehirns, während sein restlicher Körper noch am Leben erhalten wird?
Dem schließen sich weitere Fragen nach dem Umgang mit Sterben, Tod und Trauer an: Welche Bedeutung messen wir der letzten körperlichen Sterbephase bei? Wie wichtig ist ein Leichnam im herkömmlichen Sinn für das Begreifen des Tods und für die Trauerbewältigung der Hinterbliebenen?
Die Antworten auf diese Fragen fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie aus medizinischer, ethischer oder theologischer Sicht beantwortet werden. Eine einheitliche Lehrmeinung gibt es aus diesen Disziplinen nicht, einen moralisch-ethischen Konsens kann es in einer wertepluralen Gesellschaft dazu nicht geben. Vielmehr muss jeder für sich Klarheit erlangen, ob das medizinisch Machbare auch mit den eigenen Ansichten in Einklang zu bringen ist.
In den Werbebroschüren zur Organspende werden viele Bereiche, die notwendig sind, um zu einer informierten Entscheidung zu kommen, nicht thematisiert. Viele sehen sich erst im Moment eigener Betroffenheit mit der ganzen Wahrheit konfrontiert, zu einem Zeitpunkt, an dem eine durchdachte und wirklich freie Entscheidung angesichts der emotionalen Ausnahmesituation kaum möglich ist. Doch die Fragen, um die es bei einer Organspende geht, bedürfen einer Auseinandersetzung in Ruhe, mit umfassenden Informationen und mit Gesprächen im Kreis der Familie und Freunde, da diese von der eigenen Entscheidung mit betroffen sind.
Hirntot oder ganz tot?
Auf dem offiziellen Organspendeausweis kann man sich für oder gegen die Organspende nach dem Tod entscheiden. Nicht erwähnt wird, dass für diese postmortale Organspende die Körper herkömmlich verstorbener Menschen nicht zu gebrauchen sind. Als Organspender kommen nur Patienten in Frage, deren Gehirn irreversibel und vollständig versagt hat, deren Herzkreislauffunktionen aber noch durch intensivmedizinische Behandlung aufrechterhalten werden. Dies bezeichnet man als Hirntod, der laut Transplantationsgesetz (TPG) aus dem Jahr 1997 mit dem Tod des Menschen gleichgesetzt ist. Das war nicht immer so.
1968, kurz nach der ersten Herztransplantation, wurde ein Ad-hoc-Komitee der Harvard Medical School eingesetzt, um zu klären, wie man mit Patienten im irreversiblen Koma (Coma dépassé) umgehen solle. Durch die Fortschritte der Intensivmedizin sah man sich mit Patienten konfrontiert, die nicht mehr ins Bewusstsein zurückgeholt werden konnten, aber dennoch nicht verstarben. Musste man sie weiterbehandeln, oder durfte man ihre Behandlung abbrechen, da sie nicht zu retten waren? Um diese Frage zu klären, wäre die Gleichsetzung des irreversiblen Komas mit dem Tod des Menschen nicht notwendig gewesen. Das Komitee beschloss jedoch, das Coma dépassé als Todeskriterium festzulegen, da – so heißt es in der Verlautbarung – »frühere Kriterien der Todesdefinition zu einer Kontroverse bei der Beschaffung von Organen für Transplantationen führen [können].« Die Grenze zwischen Leben und Tod wurde damit verschoben: zum ersten Mal galten nun Menschen bei lebendigem Leib als tot. Diese präzise Grenzziehung war nötig, da eine Entnahme bei sterbenden Patienten – und das waren sie bis zu jenem historischen Moment – einem Totschlag gleichkommen würde.
Die Definition des Hirntods als Tod des Menschen hängt also mit der Transplantationsmedizin zusammen. Doch innerhalb der Medizin verstummte die Kontroverse um diese Gleichsetzung nicht. Mittlerweile ist auch ein wichtiges Argument widerlegt: nämlich dass ohne das Gehirn als das die Körperfunktionen integrierende Organ der restliche Körper binnen kurzer Zeit versterben würde. Vielmehr ist nachgewiesen, dass hirntote Patienten zum Teil über Jahre in diesem Zustand existieren können: In dieser Zeit sind bei ihnen unter anderem Wundheilung und Reaktionen auf bestimmte Reize zu beobachten; Kinder können zu sexueller Reifung gelangen, Schwangere über Monate ihr Kind bis zu einer gesunden Geburt austragen. All dies sind Hinweise dafür, dass auch im Hirntod integrative Leistungen des Organismus vorkommen. Namhafte Medizinethiker, die früher den Hirntod als Todeszeitpunkt des Menschen vertreten hatten, fordern heute, sich davon zu verabschieden, da das Konzept wissenschaftlich nicht mehr haltbar sei.
Das hätte weitreichende Konsequenzen: Entweder würde es das Ende der Organentnahme bei hirntoten Patienten bedeuten oder aber den Abschied von der Regel, dass nur tote Patienten Organe spenden dürfen. Wo aber setzen wir dann die Grenze? Kommen dann nicht auch andere sterbende Patienten für eine Organentnahme in Frage? Um diese Fragen zu klären, benötigen wir eine breite Debatte in der Bevölkerung. Jede und jeder Einzelne steht jetzt schon vor der Herausforderung, sich bei der eigenen Entscheidung zwischen diesen divergierenden Meinungen zu positionieren.
Auf der Intensivstation – zur Situation der Angehörigen
Erfahrbar wird die Diskrepanz zwischen herkömmlichem Todeskonzept und Hirntod auf der Intensivstation. Hirntote Patienten bringen den Angehörigen und dem medizinischen Personal Zeichen des Lebens entgegen: warme, auch errötende Haut, (künstliche) Atembewegungen und Herzschlag, um nur einige zu nennen. Ein Leichnam aber sieht anders aus: blass, kalt, starr. Diese Diskrepanz zwischen leiblicher Wahrnehmung und intellektuellem Verstehen ist kaum zu überbrücken. »Aber da war überhaupt keine Veränderung wahrzunehmen. Wir saßen da, hielten seine Hand, wir streichelten ihn. Der war ja warm. Wie sollten wir eigentlich wahrnehmen, dass der tot sei? Das war für mich so, dass das direkt wieder weg war [die Nachricht vom Tod des Kindes, Anm. der Autorin]. Und ich habe da weiter gesessen und gebetet und geglaubt: ›Der wird bestimmt wieder die Augen aufmachen. Das kann gar nicht anders sein‹«, beschreibt eine Mutter ihre Erfahrung mit der Hirntod-Diagnose bei ihrem Sohn. Um den Tod zu begreifen, braucht es einen Leichnam im althergebrachten Sinn. »Mein Sohn ist, wenn Sie so wollen, zwei Tode gestorben«, versucht der Vater eines erwachsenen Mannes, der zum Organspender wurde, seine Erfahrung in Worte zu fassen. Für ihn war dies eine zusätzliche Belastung, die er kein zweites Mal auf sich nehmen würde.
Auf Angehörige kommen weitere belastende Aspekte zu. Zum Erhalt der Organe sind viele medizinische und pflegerische Maßnahmen notwendig, die ihrem Bedürfnis nach Ruhe beim Abschiednehmen von ihrem Verwandten entgegenstehen. Belastend kann auch das Warten auf das Ende der Entnahmeoperation sein. Zwischen Hirntoddiagnose und Abschluss der Organentnahme liegt in den meisten Fällen laut Deutscher Stiftung Organspende (DSO) eine Zeitspanne von 7 bis 18 Stunden. Der Prozess kann sich vereinzelt auch deutlich länger hinziehen. Erst danach ist der hirntote Organspender zu einem Leichnam im herkömmlichen Sinn geworden und kann zur Bestattung freigegeben werden.
Eine Organentnahme greift tief in die letzte Sterbephase eines Menschen ein und fordert von den nächsten Angehörigen, auf Ungestörtheit bei der Verabschiedung von ihrem Verwandten zu verzichten. Manche tröstet die Vorstellung, dass ein anderer Mensch gerettet werden konnte. Für andere ist es zu schmerzhaft. Die Mutter des jungen Organspenders weiß heute, dass sie dieses Opfer nicht noch einmal auf sich nehmen würde: »Denn es entzieht uns den Tod, die Erfahrung des Sterbens. Das macht es sehr viel schwerer, den Abschied, den man nehmen muss, wirklich zu gehen.«
Und auf der anderen Seite?
Patienten, denen aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung eröffnet wurde, dass nur noch eine Transplantation sie retten kann, wissen zwei Dinge: 1) Ihre Lebenszeit ist begrenzt, vielleicht können sie ihren lebensbedrohlichen Zustand bereits fühlen; 2) sie warten auf den Tod eines anderen Menschen, von dem ihr eigenes Überleben abhängt. Sein Todestag wird ihr »zweiter Geburtstag« sein, wenn sie denn genügend Kraft haben, die Zeit auf der sogenannten Warteliste zu überstehen. Auch wenn die Organempfänger keine Schuld am Tod ihres Spenders trifft, ist ihr Schicksal untrennbar mit dem des Spenders verknüpft. Erst das Sterben eines Menschen unter ganz besonderen Umständen ermöglicht ihr Überleben. Das ist für viele Patienten außerordentlich belastend. Nach der Organübertragung müssen die Empfänger das neue Organ in ihren Körper und ihr Selbst integrieren. Die Erfahrung zeigt, dass das transplantierte Organ für viele mehr ist als ein medizinisches Ersatzteil, wie etwa eine künstliche Herzklappe. Sie gedenken ihres Spenders und suchen nach Wegen, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Auf direktem Weg können sie das nicht, da zwischen beiden Seiten strikte Anonymität herrscht. Die Freiwilligkeit einer Spende ist deshalb von großer Bedeutung. Sie kann helfen, das zunächst fremde Organ anzunehmen und mit etwaigen Schuldgefühlen klarzukommen, taucht doch aufgrund der in unserer Kultur bestehenden engen Verbingung zwischen Körper und Identität eines Menschen die Frage auf, ob mit dem Organ nicht auch weitere Aspekte des Spenders auf den Empfänger übergehen. Tatsächlich kann insbesondere bei den Empfängern eines Herzens das Empfinden auftreten, sich durch das transplantierte Organ auch psychisch verändert zu haben. Viele Studien führen dies auf psychische Anpassungsprobleme zurück; andere gehen davon aus, dass durch das transplantierte Herz auch weitere »Informationen« vom Spender auf den Empfänger übergehen. Zudem gilt es, auch mit den körperlichen Folgen des Eingriffs zurechtzukommen. Obwohl sich die Transplantation für viele wie eine Neugeburt anfühlt, bleibt die Lebenserwartung danach doch begrenzt. Dazu kommen viele, zum Teil gravierende Nebenwirkungen durch die starke, dauerhaft notwendige Medikation. Eine Transplantation entlässt die Patienten in einen Zustand chronischer Krankheit. Für manche sind diese Belastungen so groß, dass sie auf eine erneut notwendige Retransplantation verzichten.
Eine gesellschaftliche wie individuelle Herausforderung
Eine Organspende greift tief in das Leben eines Menschen ein, zu dem auch sein Tod und das Abschiednehmen von ihm gehören. Es gibt viele Gründe, die einen Menschen für oder gegen eine Organspende entscheiden lassen. Diese Entscheidung, wie sie auch ausfällt, gilt es zu respektieren. Damit es aber eine wirklich freie Entscheidung ist, bedarf es umfassender Information über Hirntod und die Folgen einer Organtransplantation für Betroffene und Hinterbliebene. Die Transplantationsmedizin stellt uns vor schwierige Fragen. Wir können daran persönlich wachsen, so wir den Mut zur Auseinandersetzung damit haben und uns der Brüchigkeit menschlichen Lebens stellen. Wir können auch gesellschaftlich an ihr wachsen, wenn es gelingt, diese Fragen mit Toleranz und Respekt vor den jeweils Andersdenkenden zu diskutieren.
Dr. Vera Kalitzkus (44) ist Medizinethnologin. Sie lebt in Ostholstein und arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Narrative Medizin, Biographie und Krankheitsverarbeitung sowie Familienmedizin.
Mehr Informationen für ein reifliches Überlegen
www.dank-dem-organspender.de
www.dso.de
www.initiative-kao.de
www.organtransplantation-innensichten.net
Literatur:
Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben – Warum wir Organspenden richtig finden und trotzdem davor zurückschrecken. Suhrkamp-Verlag, 2009 • Weitere Literaturhinweise sind auf www.kalitzkus.de zu finden.
Seit dem Ende der Jugoslawienkriege wirken Frauen in den betroffenen Ländern als Kondensationskerne für friedlichen Wandel.
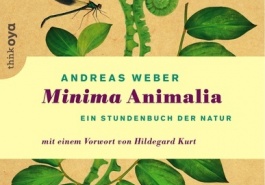
Es gibt nicht viele Wissenschaftler, die denken und schreiben wie Dichter. Letztere schreiben meist über das, was sie fühlen, erstere über das, was sie sehen. Wenn beides zusammenkommt und sich mit Gesellschaftskritik verbindet, entsteht, was wir derzeit dringend brauchen:
Selbstorganisierte Bildung jenseits von Schule – über kaum eine andere Praxis bestehen so viele Vorurteile. Clara Steinkellner gibt einen Einblick in Wirklichkeit und Motivation von Freilerner-Familien.