Biomeiler oder Grundofen?
Im Ökodorf Sieben Linden kann sich ökologische Pionier-Technik in der Praxis bewähren. Vergangenen Sommer war ein Biomeiler im Test. Hat er ihn bestanden?

Achmed Khammas ist ein Original des alten West-Berlins, das, beginnend mit den späten 1960er Jahren bis zur Wende zu einem sozialen Experimentierfeld wurde. Da gab es auf der einen Seite die Aktivisten unter den politisch motivierten Studenten, die gegen den »Muff von tausend Jahren« demonstrierten, und auf der anderen Seite die eher hedonistisch veranlagten jungen Leute, geprägt von der amerikanischen Hippiekultur. Die probten das alternative Leben, zum Teil auf dem Land als Selbstversorger, und entwickelten alternative Energietechnik wie Sonnenkollektoren. Fasziniert von diesen Entwicklungen, sollte Achmed später einer der ersten sein, die in Syrien die Dächer mit thermischen Solaranlagen schmückten.
»Ich war ein ganz normaler Junge«, erzählt mir Achmed, »ich war von Technik begeistert«. Die Eltern schenken dem Siebenjährigen ein illustriertes Heftchen mit der Geschichte von Tom Wagehals, der eine Rakete baut und mit seinen beiden Freunden in Astronautenmontur zum Mond fliegt. Eine Illustration zeigt Tom und seine Freunde auf dem Mond stehend, wie sie von dort die Erde bestaunen. Das Bild ähnelt dem Foto, das später um die ganze Welt ging: Die blaue Kugel im schwarzen All aus der Sicht der ersten Astronauten. Von da an steht fest: Achmed will Astronaut werden! Zu dieser Zeit lebt er in Syrien, wo er zur Schule geht und sein Abitur macht. Im Klassenzimmer wird er gerne als Pausenwächter eingesetzt, denn alle Kinder sitzen mucksmäuschenstill, wenn Achmed an der Tafel gekonnt Modelle von Autos zeichnet. »Kein Wunder«, sagt er, »meine Eltern waren beide Diplom-Ingenieure.«
Seine aus dem Badischen stammende Mutter und sein irakischer Vater hatten beide 1952 in Berlin ihre Prüfung zum Diplom-Ingenieur bestanden – mit Baby Achmed auf dem Arm, der einige Monate zuvor das Licht der Welt erblickt hatte. Die Begegnung seiner Eltern während der Kriegsjahre in Berlin erzählt Achmed wie eine Geschichte aus »Tausendundeiner Nacht«.
Aus dem Beduinenzelt nach Berlin
Sein Vater wurde im Irak geboren, als Sohn einer Beduinin und eines Städters, der Kontaktmann zwischen dem Stamm seiner Frau und dem Osmanischen Reich war. Der gemeinsame Sohn Mahmoud war ein wissbegieriger Junge, und als einer, der lesen und schreiben konnte, hatte das Militär Verwendung für ihn als Schreiber. Der Irak – 1920 aus drei osmanischen Provinzen gegründet – war auch zu jener Zeit ein unruhiges Pflaster. Es gab Aufstände und Kämpfe, der Vater landete in einem Gefangenenlager in der Türkei. Auf abenteuerlichen Wegen kam er nach Berlin. Dort lernte er eine sprachkundige Sekretärin in einer Regierungsbehörde kennen. Sie lehrte ihn Deutsch unter der Bedingung, dass er ihr Arabisch beibringe. Nach dem Krieg heirateten sie, und Achmeds Vater begann mit dem Studium der Ingenieurwissenschaften in Berlin.
Da er die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrschte, besuchte seine Frau Lilo mit ihm die Vorlesungen, um zu übersetzen. Da könne sie sich auch gleich selbst immatrikulieren, beschloss sie, und so bestanden beide 1952 die Diplomprüfung. Während der abschließenden mündlichen Prüfung parkte sie Baby Achmed bei der Sekretärin des prüfenden Professors. Vorher beschwor sie den Kleinen, im richtigen Moment zu schreien, denn sie befürchtete, wenn die Prüfung zu lange dauerte, würden die Sprachkenntnisse ihres Mannes womöglich nicht ausreichen. Achmed schrie im richtigen Moment, und alles ging gut.
Von der weißen Perle des Orients zurück nach Deutschland
Achmed ist gerade vier Jahre alt, als sein Vater mit ihm und seiner Mutter eine Rundreise nach Kairo, Alexandria, Beirut und Damaskus antritt. Seine Frau soll wählen, wo sie als Familie ihre Zelte aufschlagen; als Geschäftsmann wird er selbst die meiste Zeit unterwegs sein, und ihm ist es wichtig, dass seine Familie an einem Ort lebt, wo sie sich wohlfühlt. Wegen der vielen weißen Häuser wird Damaskus die »weiße Perle des Orients« genannt. Die schon im Altertum bekannte Stadt liegt fast 700 Meter hoch in angenehmer Frische, und damit steht die Wahl der Mutter fest.
Auch Achmed fühlt sich sofort in Damaskus heimisch und lernt schnell Arabisch, da er eine arabische Schule besucht. Zu Hause sprechen sie weiter Deutsch, so wie in der Familie seines tscherkessischen Freundes zu Hause weiter Tscherkessisch geredet wird. Damaskus ist multikulturell, auch die syrischen Kurden und Drusen sprechen untereinander ihre eigenen Sprachen. Arabisch dient der gemeinsamen Verständigung. Deutsch und Arabisch werden Achmeds Muttersprachen, was ihm später als Dolmetscher zugutekommt. Doch zunächst träumt er weiter davon, Astronaut zu werden. Die Science-Fiction-Romane, die er in der Bibliothek des Goethe-Instituts in Damaskus entdeckt, beleben seine Begeisterung für futuristische Technik. Nach dem Abitur will er Raketenbau und Weltraumtechnik studieren – das bleibt sein unverrückbares Ziel.
Zur Vorbereitung auf das geplante Studium beginnt er 1970 ein Maschinenbaupraktikum im Bereich Flugzeug- und Raketentechnik in Hamburg. Als er sich jedoch für ein Studium einschreiben will, eröffnet man ihm, dass sein syrisches Abitur in Deutschland nichts gilt. »Aber ich könnte damit an der Sorbonne studieren!«, entgegnet er entgeistert, was jedoch deutsche Bürokraten nicht anficht. Achmed geht nach Berlin und wird dort ohne akademischen Grad freier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU im »Brennpunkt Systemtechnik« des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik. Das sichert seinen Lebensunterhalt. Nebenher arbeitet er für das erste Berliner Stadtmagazin Hobo (später Zitty) und vertreibt syrisches Kunsthandwerk. Die Nächte verbringt er meist im »Sound«, einer angesagten Disco mit manuell betriebener Lichtorgel, deren Synchronizität mit der Musik Achmed begeistert. Der hedonistische Teil der Studentenbewegung marschiert auch auf den vielen Demos in Berlin mit, doch mit der Herausbildung eines gewaltbereiten Teils der Protestbewegung und dem Beginn des »Deutschen Herbsts« hat Achmed erst einmal genug davon, denn Gewalt lehnt er prinzipiell ab: »Das einzige, was für mich akzeptabel wäre, ist Notwehr – sonst nichts!«
Die Messiasmaschine
Mit der sogenannten Ölkrise von 1973 wurden die Fördermengen des Öls in den arabischen Staaten drastisch gedrosselt und die Preise erhöht; das bescherte den Deutschen, aber auch den Schweizern und Österreichern einige unvergessliche autofreie Sonntage. Achmed wird als Sohn eines Irakers in diesen Tagen immer wieder mit derselben Frage von Kommilitonen konfrontiert: »Was wollen deine Scheiks eigentlich?« Ihm wird schon bald klar, dass es in dieser Krise nicht nur um rein finanzielles Kalkül geht, sondern dass die Ölförderung umweltzerstörende und damit auch soziale Verwerfungen in den arabischen Ländern nach sich zieht. Von da an beschäftigt er sich mit alternativen Energiesystemen und beginnt, selbst zu experimentieren.
Da erzählt ihm ein syrischer Freund 1975 von einem Messias in Syrien. Gurus gibt es im Berlin der 70er Jahre genug – an der einen Ecke wird »Hare Krishna« gesungen, andere laufen in orangefarbener Kleidung einem Guru aus Indien hinterher. Dafür ist Achmed nicht zu begeistern. Doch als er hört: »Dieser Messias hat eine Maschine!«, hängt er an der Angel und besucht ihn in einem kleinen Dorf in Syrien. Er entdeckt einen bescheidenen, zurückhaltenden Mann, der ihm die Idee einer Maschine präsentiert, die er in einer Vision gesehen habe: Sie könne Energie erzeugen und die Menschheit erlösen, so der Messias. Sonst habe er nichts weiter zu verkünden, alles sei schon gesagt. Auf keinen Fall wolle er eine neue Religion gründen. Diese Einstellung kommt Achmed sehr entgegen. Er setzt sich eine Weile abseits unter einen Baum, um die Beschreibung der Maschine im Geist nachzuvollziehen.
Ihr Geheimnis beruht auf dem Prinzip des Wasserkreislaufs unserer Erde, den wir alle kennen: Das Wasser des Meeres verdunstet, steigt auf, verwandelt sich in Wolken und regnet wieder auf der Erde. Die Messiasmaschine soll Wasser hinaufwirbeln können – das ist die eigentliche Herausforderung bei der Konstruktion, überlegt Achmed. Das beschriebene Prinzip findet er so einleuchtend, dass er mit Freunden aus der Filmszene einen Film über den Messias und sein synergetisches Modell dreht. Er schreibt Briefe an Gott und die Welt – auch einen an den Papst – mit der Bitte, dieses Modell experimentell im großen Maßstab zu erforschen. Achmed erklärt mir das Prinzip der Verdunstung, das schon bei kleinsten Wärmeunterschieden seine Wirkung entfaltet. Ich erinnere mich an Leonardo da Vinci, der nicht nur als Maler, sondern auch als Erfinder brillierte, und den der Kreislauf des Wassers ebenso faszinierte: »Das Wasser auf unserem Planeten ist eine beständige Menge, und das ganze Leben auf der Erde ist nur durch seinen Kreislauf möglich«, so seine These. Welch grandiose Idee, diesen Kreislauf zur Energiegewinnung zu nutzen!
Für Achmed ist diese Begegnung entscheidend. Er hat seine Bestimmung gefunden: unser havariertes Raumschiff Erde zu reparieren und zu retten! Er weiß, dass die Prinzipien der Natur im wahrsten Sinn »bio«‑logisch sind und als Vorbild dienen können, um Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen, statt Methoden anzuwenden, die die Erde ausschlachten und die Menschen versklaven.
Das funktioniert hier nicht!
Von 1977 an lebt Achmed wieder ständig in Damaskus, leitet das Ingenieurbüro seiner Eltern und beginnt mit der Entwicklung und Herstellung solarthermischer Systeme und der Ausbildung von lokalen Fachkräften. Es gibt schon zu dieser Zeit einige Solaranlagen auf syrischen Dächern, doch er hört immer wieder den Satz: »Diese Anlagen funktionieren hier nicht!« Als er sie inspiziert, stellt er fest, dass sie meist nicht fachgerecht installiert sind oder nicht ordnungsgemäß gewartet wurden, weil es keine ausgebildeten einheimischen Techniker gibt. Fast zehn Jahre lang beweist er, dass solarthermische Anlagen doch funktionieren. So mancher verbrennt sich die Finger, wenn er fragt: »Wird das Wasser auch heiß genug?« Das ist für Achmeds Firma bestes Marketing: »Wenn jemand sagt: ›Das funktioniert nicht!‹, sagt der, der sich die Finger verbrannt hat: ›Doch, schau her!‹«
Auch seine Frau Konnie und seine beiden Töchter leben mit ihm in Damaskus. Gerade haben sie sich ein schönes Puppenhaus gebaut, da zieht es Achmed zurück nach Berlin. Warum, weiß er selbst nicht so genau. Im September 1989 fährt er zunächst ohne Familie zurück nach Berlin, um Arbeit zu finden. Nur drei Tage nach seiner Ankunft bekommt er das Angebot, als Vertriebsleiter eines Entwicklungs- und Umwelttechnik-Unternehmens anzufangen. Zwei Monate später fällt die Berliner Mauer.
Technische Erfindungen
Als Vertriebsleiter stattet er fortan die Wasser- und Abwasserbetriebe der ehemaligen DDR fast flächendeckend mit labortechnischen Geräten zur Schadstoff- und Schwermetallanalytik aus. Zudem baut er für seine Frau und die zwei kleinen Töchter Miriam Mey und Nadina Schirin im nunmehr vereinten Berlin ein neues Nest.
Technische Erfindungen treiben ihn weiter um. Schon zwei Jahre zuvor, 1987, hatte er ein europäisches Patent für ein geschlitztes Rotorblatt angemeldet. Als Schnittstellentechnik zwischen Strömung und Rotation könnte es überall die Effizienz steigern, bei der Erzeugung von Windenergie ebenso wie in jedem Lüftungssystem, im Computer, im Föhn – überall werden Rotorblätter verwendet. »Die stehen jedoch nur auf einem Bein«, erklärt Achmed, steht auf und zeigt, wie er auf einem Bein wackelt; auf zweien dagegen steht er sowohl stabiler als auch flexibler – das ist das Prinzip des geschlitzten Rotorblatts. Die ästhetische Optimierung der aerodynamischen Struktur in Kooperation mit dem Berliner Künstler Jörg Reckhenrich erhält 1993 den »Design Preis Schweiz«. Das Patent hat er inzwischen auslaufen lassen und zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. Es gibt praktische Anwendungen von Physikern und Schülern des Oberstufenzentrums Berlin. Auch Studenten aus Afrika nutzen die Erfindung, denn das Rotorblatt ist leicht aus ausrangierten Materialien wie alten Aluminiumblechen herstellbar.
Auch auf dem Gelände der UFA Fabrik, die Ende der 1970er Jahre von einer Gruppe experimentierfreudiger Lebenskünstler besetzt und in eine »KulturFabrik« mit dezentraler Energieversorgung umgewandelt wurde, ist ein Modell davon zu finden. Mit seinen Freunden von der UFA Fabrik verwirklicht er zudem zahlreiche ökologische Projekte, darunter auch eine Vertriebsmesse und Ausstellung zum nachwachsenden Rohstoff Faserhanf. 1995 bekommt er sogar Unterstützung für den Bau eines Modells der Messiasmaschine, das ihre Funktionweise anschaulich macht. Ihre Wirkung könnte jedoch nur ein großangelegtes Forschungsprojekt belegen.
Aus Achmeds Werkstatt kommt auch das »NETradio«, ein selbständiger Empfänger für Audiosender im Internet, für das er im Gründerwettbewerb »Multimedia 1999« einen Preis bekommt. Doch er empfindet sich nicht als Erfinder, sondern eher als ein Finder von Erfindungen.
Das »Buch der Synergie«
Achmeds Sammlung von Erfindungen zur »bio«-logischen Energiegewinnung hat einen Umfang von 2000 Seiten angenommen, als er es im Jahr 2007 unter dem Titel »Buch der Synergie« im Internet veröffentlicht – heute sind es 5000 Seiten. Es findet überwältigende Resonanz. Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer nennt es »atemberaubend« und bekennt: »Ich werde mich immer wieder an die Möglichkeit erinnern, im ›Khammas‹ nachzulesen, wenn ich über bestimmte energierelevante Fragestellungen eine Übersicht erhalten möchte.« Das »Buch« ist trotz seiner Fülle klar strukturiert und enthält unzählige Querverweise. Wer denen folgt, dem kann es passieren, dass ihn eine originelle Erfindung zur nächsten führt – und eine Reise in andere Welten beginnt wie bei Jules Verne. Oder wie in Achmeds spannenden Science-Fiction-Erzählungen, die er unter Pseudonym veröffentlicht.
Seinen Lebensunterhalt verdient Achmed seit dem neuen Jahrtausend zunehmend als Dolmetscher und Übersetzer. Auch hier ist er virtuos: Er lieh Günter Grass seine Stimme bei einer Reise in den Jemen, begleitete dorthin auch Umweltminister Jürgen Trittin, um eine Konferenz zu erneuerbaren Energien vorzubereiten, und übernahm die komplette Übersetzung zur Präsenz der arabischen Welt als Ehrengast der Buchmesse 2004 in Frankfurt. Als »Datenscheich« bloggt Achmed für die »taz«. Da ist zum Beispiel zu lesen, Wissenschaftler hätten herausgefunden, »dass die Beschallung mit Pop- und Rockmusik die Leistungsfähigkeit von Polymer-Solarzellen verbessert … und zwar deftig!«. Für »zenith«, das Magazin für den Orient, berichtet er über Systeme erneuerbarer Energien, die oft schon im Kleinen umsetzbar sind.
Im »Buch der Synergie« gibt es auch ein Kapitel über energiesparende Systeme, die er für sinnvoll hält. Energiesparen als Ideologie lehnt er jedoch ab: »Die Natur gibt alles in Hülle und Fülle, sie ist unglaublich verschwenderisch, aber sie produziert keinen Abfall, der nicht gleichzeitig von Nutzen für einen weiteren Naturprozess ist.« Wie die Natur verteilt auch Achmed seine vom Kosmos im Überfluss an ihn geschenkten Gaben und lebt bescheiden in seiner Dachwohnung im Osten Berlins. Wenn sich dort bei seinen Vollmondpartys Freunde zur Musiksession einfinden und mit Glück die weit verstreute Familie, zu der auch sein siebenjähriger Sohn Joel Salim und sein sechzehnjähriger Sohn Jannis Aziz mit ihren Müttern gehören, ist er glücklich. »Mir fehlt die Gier«, sagt er beiläufig im Gespräch. Das könnte doch auch ein (Überlebens-)Konzept für die Besatzung von Raumschiff Erde sein, denke ich still bei mir. •
Farah Lenser (59) ist Sozialwissenschaftlerin, freie Journalistin und Lektorin. Sie lebt in Berlin. www.farah-lenser.de
Vorsicht! Macht süchtig
www.buch-der-synergie.de

Im Ökodorf Sieben Linden kann sich ökologische Pionier-Technik in der Praxis bewähren. Vergangenen Sommer war ein Biomeiler im Test. Hat er ihn bestanden?
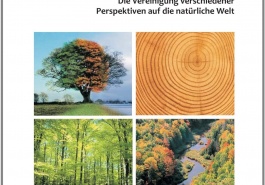
Regenwald soll gefällt werden. Ein Ökologe warnt vor der Zerstörung des Ökosystems, der dort ansässige indigene Stamm klagt über den Verlust seiner Heimat, Holzfäller haben Aussicht auf Arbeit, Umweltaktivisten planen eine Sitzblockade, und ein Politiker wird zu

Maria und Sebastian leben mit ihren drei Kindern in Berlin – zwischen Uni, Nebenjob, Kindergarten und Spielplatz. Vor einem Jahr unternahmen sie eine neunmonatige Reise nach Südamerika, wo sie inspirierende Gemeinschaften erlebten. Wieder zu Hause, suchen sie nach einer Lebensweise jenseits von Kleinfamilie.