Kaufhaus auf zwei Rädern
Ein Internetportal, ein engagiertes Team und einige Lastenfahrräder – fertig ist die Alternative zum Versandhausriesen Amazon.

Aus Hanf spinnt man keine Seide«, ist ein altmodisches Sprichwort. Es will darauf hinweisen, dass der Mensch mit dem jeweils Verfügbaren zufrieden sein soll, auch wenn das ein wenig kratzig sein mag. Dabei tut es dem Hanf unrecht. Wer die Fasern der Winter- und Sommerernte richtig mische, könne feinstes Gewebe daraus herstellen, erklärt Walter Strasheim-Weitz, Fachmann für ökologische Textilien, Finanzbuchhalter und Botschafter eines ungewöhnlichen Unternehmens: der »Hanffaser Uckermark eG« in Prenzlau. Von ihm erfahre ich, dass es nur hundert Kilometer vom Sitz der Oya-Redaktion entfernt eine Genossenschaft gibt, die Hanfbaustoffe in ihrer Fabrik produziert. Seidengleiches Gewebe könne sie in der Tat noch nicht herstellen, aber Hanf zu verspinnen, gehöre durchaus zu den Zukunftsvisionen. Seltsam, dass ich vorher noch nie von dieser Hanffabrik erfahren habe – meine ich doch, alle ökosozialen Betriebe im Umkreis von 100 Kilometer zumindest dem Namen nach zu kennen. Als Johannes Heimrath und ich den Gründer der Hanffabrik, Rainer Nowotny, in seinem Büro treffen, beginnen wir zu verstehen, wie und warum hier aufregende Dinge passieren, ohne dass viel Gewese darum gemacht wird.
»Heute Nachmittag ist keiner mehr in der Fabrik«, so entschuldigt Rainer die Ruhe auf dem Gelände, auf dem in der brütenden Sommerhitze nur ein paar getigerte Katzen träge umherstrolchen. »Weil es so heiß ist, haben die Leute beschlossen, um 6 Uhr morgens anzufangen. Das machen sie schon die ganze Woche lang so; irgendwann habe ich es dann auch mitbekommen.« Rainer fühlt sich nicht als Chef. In der zwölfköpfigen Firma gibt es keine Leitungspositionen. »Wir regeln alles durch Absprachen«, erläutert er lapidar die firmeninternen Entscheidungsstrukturen. Auf der Internetseite drückt er das etwas kurvenreicher aus: »Das Unternehmen stützt sich auf die Konzeption des selbstähnlichen und fraktalen Betriebes, das heißt es gibt keine Autorität außer der Sachkompetenz, Hierarchien richten sich nach den momentanen Erforderlichkeiten, können sich verkehren und sind vernetzt.«
Das war auch so, als Rainer den Betrieb noch als Einzelfirma geführt hat – von 1996 bis 2013. Was hat ihn zu den Naturbaustoffen gebracht? »Hanf kam auf mich zu«, lacht er. »Mitte der 1990er Jahre war die Zeit dafür reif. Mir leuchtete ein, dass wir Rohstoffe brauchen, die nicht versiegen. Hanf zieht innovative Leute an, die einem Mut machen, und so habe ich angefangen. Es war kein Problem, Landwirte zu finden, die bereit waren, Hanf anzubauen. Manche der älteren erinnerten sich noch daran, wie sie während ihrer Ausbildung in den 1960er Jahren auf Hanffeldern gearbeitet hatten.«
Das System darf dich nicht einschränken
In den 1980er Jahren, während seines Studiums der Mathematik in Ostberlin, war Rainer wie viele seiner Mitstudierenden fasziniert vom »größten Bauvorhaben der modernen Wissenschaft«, wie damals das Atomkraftwerk in Tschernobyl genannt wurde. Nach dem Super-GAU dämmerte ihm die Erkenntnis, dass zwischen Machbarkeitswahn und lebensförderlicher Technik Welten liegen. »Die Erkenntnis kam spät, aber sie kam radikal«, erinnert er sich. Seitdem sind für ihn die Energie- und die Rohstoff-Frage von höchster Bedeutung.
Aus der DDR-Zeit hat er eine weitere radikale Einsicht mitgenommen: »Du musst das bestehende System durchbrechen, um zu überleben.« Als er 1996 die ersten Ballen Dämmstoff-Hanf auf den Markt brachte, wurden sie vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIB) verboten. »Was soll der Hanf? Wir haben doch die nicht brennbare Mineralwolle! So hieß es damals beim DIB«, erinnert sich Rainer. »Dabei gilt Hanf als schwer brennbar, er qualmt nur. Mineralwollpatten hingegen werden mit Phenolharz gebunden, und das ist nicht nur hochgiftig, sondern brennt wie wild. Mir sitzt noch im Nacken, dass kürzlich in der Nähe eine mit Mineralwolle gedämmte Halle abgebrannt ist. Im Bereich der Windrichtung im Umkreis von 25 Kilometern mussten die Dörfer evakuiert werden, weil der giftige Qualm übers Land zog.«
Als das DIB blockierte, wendeten sich Rainer und sein Häuflein Mitstreiter an die EU, suchten internationale Partner und setzten durch, dass erstmals eine europaweite Norm für Naturbaustoffe aufgestellt wurde. So ließ sich Hanf als Baustoff legalisieren. »Andere konnten unsere Vorarbeit nutzen, und so belebte sich die Hanf-Branche. Ich fand das gut. Wettbewerb lässt sich sportlich nehmen. Wir brauchen noch viel mehr Hersteller von ökologischem Baumaterial. Was heute zum Beispiel an Styropor in die Häuser gesteckt wird, ist unfassbar! In ein paar Jahrzehnten bekommen wir dadurch ein massives Entsorgungsproblem.«
Vom Strohballen zur Dämmwolle
Rainer zeigt uns die Verarbeitungsstrecke. Johannes und mich packt die Begeisterung darüber, wieviel Pioniergeist die äußerlich unscheinbaren Gebäude füllt. Eine Art olivgrüner Lindwurm streckt sich durch mehrere Hallen. In seinem blankgescheuerten Maul verschlingt er die großen Walzen aus Hanfstroh, wie sie aus der Ballenpresse vom Feld kommen. In einem vier Meter hohen Turm werden sie auseinandergerissen, dann wird das aufgelockerte Stroh auf einem Fließband so lange beklopft und geraffelt, bis sich die festen, holzigen Schäben von den seidigen Hanffasern zu lösen beginnen. Wir müssen lachen: Hätte der Wimmelbilderfinder Ali Mitgutsch ein Buch über eine Fabrik gemalt, sähe sie so aus wie diese hier – Stahlgehäuse, Zahnräder, Förderbänder, Absaugtrichter, Steuerungsknöpfe, in allen Richtungen Rohrgeschlinge, das das Rohmaterial zu den einzelne Verarbeitungsstationen führt. Doch alles hat noch überschaubare Abmessungen. Den Strom für die Anlage liefert ein Blockheizkraftwerk auf dem Gelände. Könnte so eine Fabrik Teil einer Postwachstums- oder Postkollaps-Welt sein?
Für jeden Hallenabschnitt ist ein Mitarbeiter verantwortlich; wenn etwas klemmt, muss er eingreifen. »In dieser Halle ist ein relativ kleines Gerät das wichtigste: der Kollergang« – Rainer zeigt auf einen massiven Stahlkessel. »Alles andere ist zwar größer, bildet aber letztlich nur das Drumherum, indem es für den Hin- und Abtransport des Materials sorgt. Jede Halle hat eine andere Maschine, die jeweils ihren Kern bildet.« Im Kollergang werden die abgezweigten Schäben durch »kollernde« Stahlkugeln so zermahlen, dass sie zu Pellets gepresst werden können – ein hochwertiges Randprodukt der Fertigung. Im Hauptgang jedoch scheidet der olivgrüne Drache Stopf-Hanf-Dämmwolle für Dach- und Wanddämmung und Schütt-Hanf-Dämmwolle für Dachböden aus.
Maschinen zu erfinden, scheint dem Mathematiker Rainer ein besonderes Vergnügen zu bereiten. Über die Jahre hat er ein dichtes Netzwerk aus Maschinenbau-Unternehmen, Universitäten und einzelnen Fachleuten geknüpft, auf das er zurückgreifen kann, wenn er weitere Schritte in der Hanfverarbeitung gehen will. Gerade ist eine Maschine zum Mischen von Hanfschäben, Lehm und Kalk in Arbeit. Daraus sollen Hanf-Leichtbauteile entstehen. Die Versuchsbausteine, die wir in einer weiteren Halle bewundern, wurden noch von Hand zusammengemischt.
Ohne Zwang geht alles leichter
Hinter den Produktionshallen steht ein eigenartiges, gelbes Gefährt: die Erntemaschine. Wir haben Glück, sie zu Gesicht zu bekommen, denn normalerweise ist sie ab August von einem Hanffeld zum nächsten unterwegs – in einem Umkreis von gut hundert Kilometern. Die ausgewachsene Hanfpflanze ist vier bis fünf Meter hoch. Wie bekommt man sie bereits beim Mähen in handliche, für die Verarbeitung in der Fabrik geeignete Ein-Meter-Stücke? Diese Frage trieb Rainer und sein Team lange um, und die Antwort ist das gelbe Gefährt mit den zwei hohen, rotierenden Mähtrommeln. Stahlfinger führen die stehenden Hanfstengel sanft, aber nachdrücklich an horizontale Schneidmesser heran; die Meterstücke fallen dann im Schwad nach unten. »Das ist wohl die weltweit einzige Erntemaschine, die die Pflanzen zu nichts zwingt. Sie lädt sie zu einer Drehbewegung ein, und dann sind sie in der richtigen Position für den Schnitt.« Rainers Augen leuchten. Ohne Zwang arbeiten, so dass alles organisch ineinandergreift – dieses Ideal drückt sich selbst im Maschinenbau aus.
Wie kam diese Vision in sein Leben? Hat Rainer immer schon davon geträumt? Warum spricht er am liebsten von der guten Zusammenarbeit mit all seinen Partnern?
»Naja, ich bin auch ein Kommunarde«, Rainer lächelt etwas verlegen und verwendet bewusst einen westdeutschen Begriff, um sich zu erklären. »Wir haben uns früher nicht so genannt; zu Studienzeiten hieß das bei uns ›Wohnungsmangel‹. Es gab auch im Osten studentische Wohngemeinschaften, wenn auch etwas versteckt. Manche gingen von dort in bürgerliche Strukturen zurück, andere, wie ich, blieben dabei. Meine Kinder leben heute noch in einer Gemeinschaft. Inzwischen wohne ich zwar im eigenen Haus, aber Eigentum ist mir nicht wichtig. Die Fabrik kann ich nicht mit ins Grab nehmen. Die jüngere Geschichte zeigt, wie schnell sich Eigentums-Situationen radikal ändern können. Die nächste Gesellschaft wird alles über den Haufen werfen, was heute als sicheres Eigentum gilt. Den heutigen Strukturen weine ich keine Träne nach.«
Gemeinsam mehr erreichen
Gerne hätte Rainer die Hanffabrik von Anfang an als Genossenschaft aufgezogen, doch hatte er 1996 niemanden gefunden, der mitmachen wollte. Dann dauerte es lange, bis er sich die Umwandlung der Einzelfirma in eine gemeinschaftliche Struktur zutraute. Erst als aus eigenem Umsatz alle Kredite, die er für den Bau der Maschinen aufgenommen hatte, zurückgezahlt waren, fühlte er sich dazu bereit. Heute zählt die Genossenschaft knapp 20 Mitglieder; begonnen hat er sie 2013 mit drei Partnern: einem Lehmbauer aus der Gegend, einem Maschinenbauer aus Hannover und Jörg Wolschina, einem langjährigen Freund und Weggefährten.
Wir treffen Jörg in den Verkaufsräumen des »Naturbauhofs« im Straßengiebelende der langen Hauptfabrikhalle. Ursprünglich hat er als Tischler gearbeitet und durch Rainer schon in den 1990er Jahren Hanf als Alternative zur ungeliebten Mineralwolle kennengelernt. Im Jahr 2000 hatte Rainer ihn schließlich überredet, den Vertrieb der Hanfprodukte für die Region um Prenzlau herum zu übernehmen, und vor fünf Jahren zog er den Naturbauhof als Ladenlokal auf. Aber es ist mehr als ein Laden: Da viele Handwerker nicht bereit oder in der Lage dazu sind, den unkonventionellen Dämmstoff Hanf zu verarbeiten – er kommt ja nicht nach Baumarkt-Manier passgenau zugeschnitten daher –, vermittelt Jörg seinen Kunden mit Hanf vertraute Fachleute. Mittlerweile ist ein enger Gewerkeverbund entstanden: Ergibt sich über den Naturbauhof ein größeres Projekt, werden alle Kosten und Einnahmen offengelegt, und die Beteiligten teilen sich den Gewinn. »Das ist eine infomelle Struktur«, erklärt Jörg. »Hier arbeiten lauter Selbständige zusammen. Das Bindeglied ist die Freundschaft.«
Freundschaften zu pflegen, das scheint hier das Wichtigste zu sein. »Ich kenne viele unserer Händler persönlich«, erzählt Jörg. »Von ihnen kamen immer wieder Ideen, zum Beispiel für neue Produkte. Wenn es irgendein Problem gibt, rufen wir uns an, und das ist immer so, als hätte ich einen Freund am Telefon.« Einige Händler sind inzwischen in die Genossenschaft eingestiegen. Das Netz der Verbundenheit geht aber über die formelle Mitgliedschaft hinaus. »Der Maschinenbauer aus Waren, mit dem wir die Erntemaschine entwickelt haben«, wirft Rainer ein, »ist zum Beispiel kein Genosse, aber ganz fest mit uns verschweißt. Wann immer ich mich bei ihm melde, hat er ein Ohr für mich. Gemeinsam etwas zu entwickeln, das macht eben Spaß und schmiedet zusammen.«
Für Jörg war die Genossenschaftsgründung ein Schritt, der an der Art der bisherigen Zusammenarbeit nichts geändert hat, sondern dem, was ohnehin gelebt wurde, nun die stimmige Form verleiht. Er hat sich dafür stark gemacht, dass die Präambel der Satzung an die politische Idee der ersten englischen Genossenschaften erinnert: Gemeinsam mehr erreichen und sich nicht von kapitalistischen Strukturen ausbeuten lassen.
Öl, Tee, Papier, Tauwerk, Stoff, Segeltuch, Dämmwolle, Pellets …
Der partnerschaftliche Erfindergeist hat auch Walter Strasheim-Weitz angezogen, als er 2013 auf der Suche nach Möglichkeiten war, sich für solidarische Ökonomie zu engagieren. Als Buchhalter hatte er jahrelang bei »Hess Natur« mit Zahlen jongliert. Als die Übernahme des Ökotextilien-Pioniers durch einen Investmentfonds drohte, stieg er aus und engagierte sich für die Gründung der »hngeno«, einer Genossenschaft, die Hess Natur freikaufen wollte. Leider scheiterte dieser Plan, und so suchte Walter Neuland. Dass Rainer und sein Team langfristig auch über die Produktion verspinnbarer Fasern nachdenken, begeisterte ihn. Seitdem unterstützt er die Hanffabrik in der Buchhaltung und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Sein Traum ist, weitere genossenschaftlich organisierte Hanffabriken zu initiieren. In seiner Heimat Nordhessen ist er mit einigen Bauern bereits im Gespräch. Wäre das eine Konkurrenz für die Uckermark? »Nein«, beteuert Rainer. »Ich wünsche mir seit langem, dass es in jedem Bundesland eine Hanffabrik gibt. Ich liefere gerne alles nötige Wissen dafür, wenn jemand starten möchte. Die Kunden zwischen Berlin und der Ostsee reichen mir.«
Wirtschaftswachstum? Verdrängungswettbewerb? Das sind hier Fremdwörter. Was noch schier unbegrenzt wachsen kann, ist das Spektrum an nützlichen Dingen, die sich aus Hanf herstellen lassen. Walter Strasheim-Weitz betet die »Hanfkette« herunter: Aus den Samen lässt sich hochwertiges Speiseöl pressen, die proteinhaltigen Reste der Ölpressung eignen sich für Müsliriegel oder Tierfutter. Die Blätter ergeben einen heilsamen Tee, und aus dem Stengel der Pflanze kann Papier bester Qualität gewonnen werden. Hanffasern lassen sich zu feinen Garnen verspinnen und zu Seilen, feinem Stoff oder schwerem Segeltuch verarbeiten. Nicht zuletzt ist da noch die gesamte Palette an Baustoffen vom Werg zum Kalfatern über Dämmwolle bis hin zum Hanf-Lehm-Stein.
»Mein Traum ist, irgendwo die gesamte Hanf-Produktpalette regional herstellen zu lassen, und zwar von solidarisch organisierten Betrieben. Ökologische Urproduktion und selbstverwaltete Unternehmen, das gehört für mich zusammen.«
Die Hanffabrik ist also erst der Anfang! Keine Frage, Hanf als Baustoff ist großartig, aber hier geht es um viel mehr. Hanfprodukte zeigen beispielhaft, dass das Prinzip regionaler, solidarisch organisierter Produktion nicht bei Landwirtschaft und Gartenbau haltmacht, sondern sich auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen lässt. Für diese Idee müssten sich doch viele Menschen begeistern lassen, und Mitglied in Genossenschaften wie der Hanffaser Uckermark eG werden – oder selbst welche gründen! •
Prenzlau ist einen Besuch wert
www.hanffaser.de

Ein Internetportal, ein engagiertes Team und einige Lastenfahrräder – fertig ist die Alternative zum Versandhausriesen Amazon.

Vor drei Jahren erzählte eine Oya-Reportage von Lea Gathen (Ausgabe 13), wie sich die Vision der Gemeinschaft »Lauter Leben« im Dorf Kanin im Landkreis Potsdam zu verwirklichen begann. Seitdem hat die Gruppe etliche Herausforderungen gemeistert – Grund, sie erneut zu besuchen. Ortrun Schütz war vor Ort und hat sich vom »lauten Leben« beeindrucken lassen.
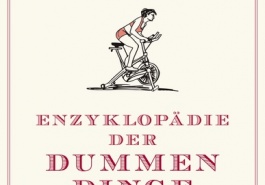
Eine schmale Brücke in einem italienischen Dorf: Der Autofahrer muss auf Entgegenkommende achten und sich zur Not per Rückwärtsgang mit ihnen arrangieren. Eines Tages steht eine Ampel da. Nun warten die Fahrer vor der technischen Obrigkeit – von jeglicher Verantwortung für