Wie Ideen fliegen lernen
In vielen Menschen schlummern Ideen, in ihrer Region etwas zum Positiven zu verändern. Oft ist nur ein kleiner Anstoß nötig, damit sie Wirklichkeit werden.

Zivilgesellschaftliches Engagement – ist das nicht ein endloses Klein-klein? Die »Halbinseln des guten Lebens« wachsen langsam, und die Flut an Waren, die täglich aus aller Welt auf kleine wie große Ortschaften einprasseln, schwillt unbegrenzt an. Wenn sich Menschen in Dörfern, Städtchen oder Stadtvierteln für gemeinwohlorientierte Anliegen engagieren – wie kann da mehr zustandekommen als das eine oder andere Zugeständnis seitens der Politik oder der Aufbau einer kleinen Enklave? Was könnten Hebel für einen langfristig nachhaltigen Wandel sein, der nicht an der Tür eines Dorfladens oder am Rand eines Stadtgartens vom globalisierten Turbokapitalismus hinweggefegt wird? Mit dieser Frage setzten sich Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe auseinander.
»Den Hebel suche ich schon lange«, erklärt Jürgen Osterlänger, der sich im wohlhabenden Franken als Kreisrat engagiert. »Ich glaube, dass wachsende Not ›not‹wendig ist. Dann erst sehen die Leute, dass es ernst ist. Für diejenigen, für die das System noch funktioniert, ist es nur eine Spielerei, sich nachhaltige Lebensweisen anzugewöhnen.«
Einen exemplarischen Hebel haben die Bürgerinnen und Bürger von Mals in Südtirol in die Hand bekommen. Sie beschlossen per Volksabstimmung, dass auf dem Land der Gemeinde keine Pestizide angewandt werden dürfen, und fällten damit eine kollektive Entscheidung gegen eine globale Industrie. Würde ihnen ein nennenswerter Prozentsatz der Gemeinden in Europa nacheifern, würde eine gesellschaftliche Diskussion im Spannungsfeld zwischen lokalem Bürgerwillen und globalen Zwängen losbrechen: Die Pestizidindustrie und die mit ihr verbundene Agrarindustrie gelten in der Wachstumsökonomie als ebenso »systemrelevant« wie die Großbanken. Freilich ist die Verwirklichung des Traums vieler Gemeinden, die sich reinen Ökolandbau auf ihren Flächen wünschen, sehr unwahrscheinlich. Aber hin und wieder von friedlichen Umwälzungen zu träumen, trägt dazu bei, den Blick für sinnvolle nächste Schritte zu öffnen: »In Mals waren die Bürgerinitiativgruppen, die sich mit ganz unterschiedlichen Ansätzen einbringen und damit alle Bevölkerungsschichten vertreten und motivieren konnten, der Schlüssel zum Erfolg«, erklärt Jane Kathrein, die sich vor Ort ein Bild verschafft hat. »Eine Bewegung mit einer breiten Basis – vom Apotheker bis hin zum Schüler, vom Biobauern, dem Bürgermeister bis zur Friseurin – hat eine große Kraft und kann nachhaltig wirken.«
Burkhardt Kolbmüller, Regionalentwickler aus Thüringen, findet, »dass ein Dorfladen oder ein Stadtgarten keine Kleinigkeiten sind, sondern etwas Großartiges. Ich halte es für wenig sinnvoll und methodisch irreführend, konkretes Engagement vor Ort – das ›Kleine und Unwichtige‹ – gegen politische Aktionen innerhalb oder außerhalb der politischen Strukturen auszuspielen oder aufzurechnen. Sicher sind hin und wieder plakative Interventionen wie Demos oder Sitzblockaden notwendig. Aber erstens werden das immer nur Ausnahmesituationen bleiben, und zweitens glaube ich daran, dass viele kleine Schritte die Welt stärker verändern als große radikale Entwürfe; wahrscheinlich braucht man beides in einem sinnvollen Verhältnis. Für die individuelle ›psychische Hygiene‹ ist Engagement vor Ort zentral wichtig – andernfalls wird man depressiv, zynisch oder verrückt …«
Auch Thomas Oser, Philosoph und in der Stadtentwicklung von Nürtingen engagiert, singt ein Loblied auf das scheinbar Kleine: »Anders als bei einer Delegiertenkonferenz, einer Demonstration oder einer Internetkampagne – die alle beziehungsmäßig Affären gleichen – kommt lokales politisches Engagement einer Ehe gleich: Man bekommt nicht nur die Schokoladenseiten zu sehen; man kann sich auch nicht einfach entziehen, wenn es mal schwierig wird, sondern ist weitgehend immer da – permanente Präsenz, und zwar nicht nur mit einer Facette meines Seins, sondern mit Haut und Haaren! Überregional kann man sich leichter hinter äußeren Transformationen – also zum Beispiel hinter der Formulierung von politischen Programmen wie der Energiewende – verstecken, lokal gelingt dies zum Glück nicht: Hier geht ohne eine unauflösliche Verschränkung von innerer und äußerer Transformation gar nichts – oder zumindest nicht viel.«
Die Hürden in den Köpfen wegräumen
Es gibt Orte, wo diese Verschränkung zu spannenden Situationen führt, zum Beispiel in Jena, wo nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen die Überbauung des zentral gelegenen Eichplatzes die Politik in eine Art Schockstarre gefallen ist (siehe Seite 10). Die Menschen glaubten nicht mehr an Reformen, erzählt Arne Petrich vom Online-Magazin »Jenapolis«; sie wollten eigene Foren für Meinungsfindung und Umsetzung aufbauen. Wie aber könnten solche neuen Strukturen aussehen? Jascha Rohr vom Institut für Partizipatives Gestalten ist überzeugt: »Wenn man wirklichen Wandel erreichen möchte, muss man den Code, die DNA eines Kollektivs aus Menschen und Orten verändern. Meiner Erfahrung nach gelingt das nur über eine tiefe, offene und angstfreie Auseinandersetzung mit dem Bestehenden, durch neue Erfahrungen, durch eine kontinuierliche Arbeit an inneren Haltungen und durch sichtbare äußere Erfolge, die die inneren Veränderungen manifest machen und in ihrem Sinn wirken. Das klingt ein wenig abstrakt, aber es zeigt einen weiteren Weg, der vor dem Verrücktwerden bewahren kann: Am Kern der Sache arbeiten, an der ›DNA‹ der ressourcen- und fortschrittssüchtigen Kultur – und das nicht nur in der Theorie, sondern in konkreten Schritten vor Ort.«
»Ich halte alle Aktivitäten für sinnvoll und dringend notwendig, die die Wertschöpfung wieder zurück in die Region verlagern und dem globalen Markt entreißen«, betont Burkhardt Kolbmüller. »Das betrifft insbesondere den Lebensmittelbereich, aber auch den Bereich der sozialen Fürsorge oder viele Handwerke. Problematisch ist, dass wir traditionelles Wissen und Fertigkeiten verlieren, aber da tut sich landauf, landab ja einiges.«
Jane Kathrein erzählt dazu aus ihrem Heimatort Innsbruck: »Bei uns zeigt sich gerade an einem Dachgartenprojekt einer nicht-profitorientierten Kultureinrichtung, wie sich die Nachbarschaft und ihre Themen verändern. Die Bewohner des Stadtviertels beginnen, sich für ihren Lebensraum zu interessieren. Sie lernen, Autoritäten in Frage zu stellen, überdenken ihr Konsumverhalten und bekommen wieder eine Verbindung zu dem, was uns nährt. Auch eine Kindergartengruppe nutzt den Garten – und das ist nur eines von vielen Beispielen aus der Stadt. Die Gemeinwohlökonomie-Gruppe arbeitet bereits in einzelnen Betrieben an einem neuen Wirtschaftssystem, im Tauschring ›Talentenetz Tirol‹ wird die Wertigkeit von Dienstleistungen überdacht, und es gibt vieles mehr. Politische Hürden abzubauen, ist wohl ein viel langwieriger Prozess, als neue Ideen in die Tat umzusetzen.«
»Die Hürden sind in den Köpfen«, betont Jürgen Osterlänger. »In meinem Traum wird die enkeltaugliche Entwicklung Hauptthema in der Gemeinde, einer Region. Viele machen mit, strengen sich an, sind kreativ im Finden von neuen bzw. alten Kulturtechniken, suchen zum Beispiel Anregungen in Ökodörfern. Die Gemeinschaft übt sich sowohl als Geburtshelfer für nachhaltige Strukturen und als Sterbebegleiter von Überkommenem.«
Sterben ist ein Tabu in einer Welt, in der alles größer, schöner und besser werden soll. Lassen sich im zukunftsfixierten Europa Menschen für Sterbeprozesse begeistern? Offenbar ja. Thomas Oser meint: »Nicht verbissen zu kämpfen, sondern sich eine gewisse Leichtigkeit und vor allem den Humor zu bewahren – das ist wichtig! Gerade dann, wenn man darauf vertraut, dass der Gegner ein absterbendes System vertritt, sollte man auch etwas Nachsicht walten lassen – wie ein Begleiter, der den Sterbenden dabei unterstützt, friedlich zu gehen. Für eine solche Haltung ist der direkte Kontakt, wie er in der politischen Arbeit vor Ort an konkreten Projekten möglich ist, wesentlich – denn diese Art von Mitgefühl kann ich besser entwickeln, wenn ich ›meinen Sterbenden‹ auch persönlich kenne.«
Knospenbildung
Ein organischer Sterbeprozess verläuft immer parallel zur Geburt des Neuen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, bereiten sich schon die Knospen auf den Frühling vor. Was wächst in heutigen Gesellschafts-Knospen? Fremdenhass? Das immer perfektere Smartphone? Oder hie und da vielleicht die Sehnsucht nach einem guten Leben? Knospen brauchen geschützte Räume, um sich auf Wachstum vorzubreiten. Wie müssten sie gestaltet sein, die Experimentierregionen für gutes Leben?
»Bei Licht betrachtet, nicht so viel anders als in der Wirklichkeit« – Burkhardt Kolbmüller würde dort mit der Arbeit in Gärten, Obstwiesen und Kulturlandschaften beginnen. »Das sind positive Ansätze, die viele Menschen ansprechen, und zugleich Dinge, die wir zukünftig dringend brauchen werden. Zentral sind für mich Netzwerke – innerhalb einer Region, aber auch weit darüber hinaus; Netzwerke mit Gleichgesinnten, aber auch solche, die ›nur‹ einen kleinen gemeinsamen Nenner als Basis haben. Inhaltlich würde ich Dialoge über Kategorien wie Glück, Heimat, Schönheit oder Zeitwohlstand führen. Es wäre toll, wenn sich die Menschen einer Region, ungeachtet ihrer Verschiedenheit, auf einige gemeinsame Punkte verständigten, die für ein gutes Leben unverzichtbar sind.«
»Wichtig wäre, nicht schon zu meinen, die richtige Lösung zu kennen«, mahnt Jascha Rohr. »Wenn sie schon gesetzt ist, ist Emergenz – also das Entstehen von etwas wirklich Neuem – nicht mehr möglich. In einer Experimentierregion ginge es für mich daher darum, die Lebensbedingungen für alle und alles zu verbessern und mehr Lebendigkeit zu erzeugen. Was dazu der beste Weg ist, müsste jede Region anhand ihrer eigenen Bedingungen herausarbeiten können: zum Beispiel durch Kommunewerkstätten, in denen kollaborativ Lösungen entwickelt werden. Kommt in einer solchen Werkstatt womöglich heraus, dass neue und bisher undenkbare Formen von Gemeingütern geschaffen und Bedürfnisse subsistent befriedigt werden sollen, wäre das ein vorstellbares und tolles Ergebnis. Aber ich hätte die Hoffnung, es wäre vielleicht ein ganz anderes, das wir alle noch gar nicht sehen.«
Jane Kathrein würde ihren Versuch in einem entsiedelten Dorf im Süden Europas beginnen: »Die Gemeinschaft könnte sich in einem Permakulturgarten versorgen, eine Gemeinschaftsküche einrichten, eine freie Dorfschule gründen – die Energieversorgung wäre noch zu klären. Mit jedem Menschen kämen neue Qualitäten und neue Möglichkeiten hinzu, ebenso die Herausforderung, Perspektiven zu wechseln und in einer wertschätzenden Art miteinander umzugehen. Wichtig erscheint mir, dass die Entwicklung offen bliebe und Verbindungen zum Umfeld gepflegt würden.«
Ja, würden auch »Menschen von nebenan« – also nicht nur eine kulturkreative Elite – gerne Teil solcher Experimente sein? Ich durfte einmal dabei sein, als »ganz normale« Nachbarn auf die Frage »Wenn Geld keine Rolle spielte – wie würdet ihr gerne leben und arbeiten?« antworteten. Niemand wollte eine Luxusvilla mit Whirlpool. Die Menschen sahen sich in Gärten, auf Weiden oder in Werkstätten. Sie sahen sich Zeit mit ihren Kindern und Freunden verbringen. Komfort schien zweitrangig – wichtig war, dass es keinen Stress gäbe, weder am Arbeitsplatz noch durch die Politik. Ich hätte keine Angst davor, mit solchen Menschen einen kollektiven Prozess zu beginnen, der alle heutigen Sachzwänge in Frage stellen darf. Schritt für Schritt könnte sich dabei zeigen, was sterben und was neu wachsen will. •

In vielen Menschen schlummern Ideen, in ihrer Region etwas zum Positiven zu verändern. Oft ist nur ein kleiner Anstoß nötig, damit sie Wirklichkeit werden.

Inklusion – das will das Gesetz, doch wie steht es um die Umsetzung? Worauf kommt es an, damit junge Menschen, die besondere Begleitung benötigen, sich nicht als Außenseiter fühlen?
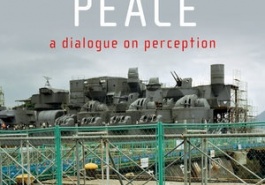
Die Möglichkeit und Unmöglichkeit des Friedens ist ein zentrales Thema in Wim Wenders’ Filmen. »Noch niemandem ist es gelungen, ein Epos des Friedens anzustimmen«, sinniert Curt Bois in »Der Himmel über Berlin«. »Was ist denn am Frieden«,