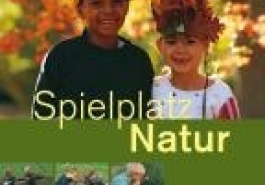GemeinschaftÜber das Glück, …
… ein Gemeinschaftsklo zu putzen.von Susanne Becker, erschienen in Ausgabe #1/2010Ich war noch neu und unverbraucht, als ich schon bald nach meinem Einzug ins Ökodorf Sieben Linden einen Job übernahm, der »Koordinatorin der Gemeinschaftsdienste« hieß. Er hätte auch »Big Mama« oder »die Polizeichefin« heißen können. Ich habe diese Arbeit jedenfalls mit viel Engagement begonnen. Selbst beim Leeren der Kloeimer hatte ich oft ein richtiges Glücksgefühl! Glücklich machte der Gedanke, mit dieser Arbeit meinen Teil zum großen Ganzen beizutragen.
Fast zwei Jahre lang habe ich für den Verein »Freundeskreis Ökodorf e. V.« die Gästeinfrastruktur organisiert. Dieser Verein ist für den Bildungs- und Seminarbetrieb zuständig. Mit drei jungen Leuten, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr hier verbrachten, und einem Mann für das Handwerkliche habe ich dafür gesorgt, dass unsere Gäste sich möglichst wohlfühlten. Dabei gab es eine Herausforderung: Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste nutzen dieselben Bäder und essen in denselben Räumen. Vor allem in der warmen Jahreszeit vermischt sich das Gemeinschaftsleben mit dem der Gäste in unserem Innenhof oder auch an unserem »Strand« am Teich. Es gibt viele Berührungspunkte, was sowohl bereichernd als auch anstrengend sein kann.
Alle Dorfbewohner absolvieren als Gegenleistung für die Nutzung des Gemeinschaftshauses eine bestimmte Anzahl an Stunden Gemeinschaftsdienst in der Woche. Sie heizen die Holzöfen,bereiten das Frühstück und das Abendessen oder leeren Kompostkloeimer. Es sind etwa 120 Stunden, die wöchentlich von uns allen geleistet werden – oder besser geleistet werden sollten. Denn dem reibungslosen Ablauf dieses großen Arbeitsorganismus stehen unterschiedlichste Widerstände im Weg: Das reicht von schlichtweg den Dienst vergessen bis zu diversen Unpässlichkeiten, die es einem gerade leider unmöglich machen, den Job zu tun.
Was sollte ich aber tun, wenn am Freitagabend eine Gästegruppe naht, und Bäder und Klos in einem Zustand waren, den ich den Gästen lieber vorenthalten würde
Anerkennung für historische Drecksarbeit
Mein Dilemma war in solchen Situationen, dass ich meist Verständnis für die Menschen hatte, die zuständig gewesen wären. Ich kannte ihre Gründe. Gleichzeitig aber hatte ich den Druck und den Wunsch, dass »der Laden läuft«. Eine Weile ist es mir trotzdem gut gelungen, diejenigen, bei denen es nicht rund lief, zu motivieren. Doch mehr und mehr machte sich Unmut in mir breit. Ich bin ein Mensch, der geliebt werden möchte. Oft aber hatte ich jetzt, wenn ich zum Essen ins Gemeinschaftshaus ging, mit jedem sechsten Menschen, der mir über den Weg lief, etwas wegen der Dienste zu klären. Und irgendwann verspürte ich keinerlei Lust mehr, mit jemandem über die Stundenzahl, die eigentlich nach unserem ausgeklügelten Punktesystem abgearbeitet werden sollten, zu verhandeln. Zu diesem Unmut gesellte sich noch Neid auf diejenigen, die in den Seminaren kreative und kommunikative Arbeit taten und damit im Rampenlicht standen. Ich sah sie dann als die abgehobenen »feinen Herrschaften«, während ich zusammen mit dem anderen Bodenpersonal beständig den Rahmen hielt.
Sowohl was die Anerkennung als auch den Verdienst betrifft, besteht also selbst in einer Gemeinschaft, die sich bewusstes Leben auf die Fahnen schreibt, noch ein Missverhältnis zwischen diesen beiden Arbeitsebenen. Die eigentliche Drecksarbeit ist dabei, dass hier unerlöste historische Rollenkonzepte auf eine Person übertragen werden.
Während der Intensivzeit unserer Gemeinschaft im letzten November hatte ich einen Forumsauftritt zu diesem Thema. Das Forum ist in vielen Gemeinschaften ein hilfreiches Werkzeug der Kommunikation, um auch die tieferen und allgemeineren Dimensionen einer konkreten Person und Situation sehen zu können. Dabei tritt der betroffene Mensch in den Kreis der Gemeinschaft und kann frei sprechen und sich zeigen. Auch ich konnte so auf spielerische Art und Weise meinen Ärger ausdrücken und die Gemeinschaft um Feedback für meine Arbeit bitten. Durch die große Anerkennung und das erkennende, wohl auch selbstkritische Lachen, wurde mir deutlich, dass viel mehr Wertschätzung und Verständnis vorhanden war, als ich wahrgenommen hatte.
Meine Arbeit wird eine Nachfolgerin übernehmen. Elke Gehle wird das ganze System umstrukturieren und es hoffentlich effektiver und entspannter machen. Über ihre Ideen zu dieser Arbeit sagt sie:
»In jeder Gemeinschaft wohnt ein ›Herr Niemand‹ mit, und den kann man auch nicht rausschmeißen. Oft macht nur dieser Niemand die unbequemen Dinge. Er hilft uns, ganz Mensch sein zu dürfen, schwach, nachlässig und faul. Ich glaube, das brauchen auch Erwachsene noch. Wichtig ist, dass dieser Anteil bei einem selbst bleibt und dass wir dem Niemand mit Achtung begegnen und ihn auch begrenzen. Er darf nicht an die Stelle des Geschäftsführers treten.«
Möge es in Zukunft noch besser gelingen, zugleich sich selbst und dem Ganzen zu dienen. Und dabei glücklich beim Putzen eines Klos zu sein!
weitere Inhalte aus #1 | Wovon wir alle leben